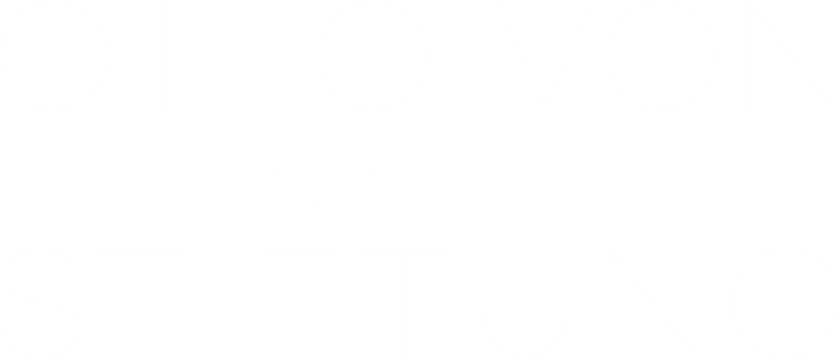Brief an Leopold von Gerlach, Frankfurt, 2. Mai 1857
Verehrtester Freund,
gestern habe ich die Freude gehabt, Ihren Brief vom 29. zu erhalten, und muß meine Antwort leider mit dem Ausdruck meines herzlichen Antheils an Ihren häuslichen Leiden beginnen; ich kann es Ihnen aus eigner Erfahrung, wenn auch bisher nicht aus so ernster, nachempfinden, wie schwer es ist, unter dem Druck von Kummer und Sorgen dieser Art sich Theilnahme für die Vorgänge der Außenwelt zu bewahren; und doch ist die Nothwendigkeit, es zu thun noch immer das nützlichste äußre Gegengewicht, und ich halte es deßhalb nicht für unerlaubt, Sie mit Discussion über den politischen Inhalt Ihres Schreibens in Anspruch zu nehmen.
So einstimmig wir in Betreff der innern Politik sind, so wenig kann ich mich in Ihre Auffassung der äußern hineinleben, der ich im Allgemeinen den Vorwurf mache, daß sie die Realität ignorirt. Sie gehen davon aus, daß ich einem vereinzelten Manne, der mir imponire, das Princip opfre. Ich lehne mich gegen Vorder- und Nachsatz auf. Der Mann imponirt mir durchaus nicht. Die Fähigkeit, Menschen zu bewundern, ist in mir nur mäßig ausgebildet, und vielmehr ein Fehler meines Auges, daß es schärfer für Schwächen als für Vorzüge ist. Wenn mein letzter Brief etwa ein lebhafteres Kolorit hat, so bitte ich das mehr als rhetorisches Hülfsmittel zu betrachten, mit dem ich auf Sie habe wirken wollen.
Was aber das von mir geopferte Princip anbelangt, so kann ich mir das, was Sie damit meinen, concret nicht recht formuliren und bitte Sie, diesen Punkt in einer Antwort wieder aufzunehmen, da ich das Bedürfniß habe, mit Ihnen prinzipiell nicht auseinander zu gehen. Meinen Sie damit ein auf Frankreich und seine Legitimität anzuwendendes Princip, so gestehe ich allerdings, daß ich dieses meinem specifisch Preußischen Patriotismus vollständig unterordne; Frankreich interessirt mich nur insoweit, als es auf die Lage meines Vaterlandes reagirt, und wir können Politik nur mit dem Frankreich treiben, welches vorhanden ist, dieses aber aus den Combinationen nicht ausschließen. Ein legitimer Monarch wie Ludwig XIV. ist ein ebenso feindseliges Element wie Napoleon I., und wenn dessen jetziger Nachfolger heut auf den Gedanken käme zu abdiciren, um sich in die Muße des Privatlebens zurückzuziehn, so würde er uns gar keinen Gefallen damit thun, und Heinrich der Fünfte würde nicht sein Nachfolger sein; auch wenn man ihn auf den vacanten und unverwehrten Thron hinaufsetzte, würde er sich nicht darauf behaupten. Ich kann als Romantiker eine Thräne für sein Geschick haben, als Diplomat würde ich sein Diener sein, wenn ich Franzose wäre, so aber zählt mir Frankreich, ohne Rücksicht auf die jeweilige Person an seiner Spitze, nur als ein Stein, und zwar ein unvermeidlicher in dem Schachspiel der Politik, ein Spiel, in welchem ich nur meinem Könige und meinem Lande zu dienen Beruf habe.
Sympathien und Antipathien in Betreff auswärtiger Mächte und Personen vermag ich vor meinem Pflichtgefühl im auswärtigen Dienste meines Landes nicht zu rechtfertigen, weder an mir noch an Andern; es ist darin der Embryo der Untreue gegen den Herrn oder das Land, dem man dient. Insbesondre aber, wenn man seine stehenden diplomatischen Beziehungen und die Unterhaltung des Einvernehmens im Frieden danach zuschneiden will, so hört man meines Erachtens auf, Politik zu treiben, und handelt nach persönlicher Willkühr. Die Interessen des Vaterlandes dem eignen Gefühl von Liebe oder Haß gegen Fremde unterzuordnen, dazu hat meiner Ansicht nach selbst der König nicht das Recht, hat es aber vor Gott und nicht mir zu verantworten, wenn er es thut, und darum schweige ich über diesen Punkt.
Oder finden Sie das Prinzip, welches ich geopfert habe, in der Formel, daß ein Preuße stets ein Gegner Frankreichs sein müsse? Aus dem Obigen geht schon hervor, daß ich den Maßstab für mein Verhalten gegen fremde Regirungen nicht aus stagnirenden Antipathien, sondern aus der Schädlichkeit oder Nützlichkeit für Preußen, welche ich ihnen beilege, entnehme. In der Gefühlspolitik ist garkeine Reciprocität, sie ist eine ausschließlich Preußische Eigenthümlichkeit; jede andere Regirung nimmt lediglich ihre Interessen zum Maßstabe ihrer Handlungen, wie sie dieselben auch mit rechtlichen oder gefühlvollen Deductionen drapiren mag. Man acceptirt unsre Gefühle, beutet Sie aus, rechnet darauf, daß sie uns nicht gestatten, uns dieser Ausbeutung zu entziehn, und behandelt uns danach, d. h. man dankt uns nicht einmal dafür und respectirt uns nur als brauchbare dupe.
Ich glaube, Sie werden mir recht geben, wenn ich behaupte, daß unser Ansehn in Europa heut nicht dasselbe ist wie vor 1848, ich meine sogar, es war größer zu jeder Zeit zwischen 1763 und 1848, mit Ausnahme natürlich der Zeit von 7 bis 13. Ich räume ein, daß unser Machtverhältniß zu andern Großmächten, namentlich aggressiv, vor 1806 ein stärkeres war, als jetzt; von 15 bis 48 aber nicht, damals waren ziemlich alle, was sie jetzt noch sind, und doch müssen wir sagen, wie der Schäfer in Goethes Gedicht: „ich bin heruntergekommen und weiß doch selber nicht, wie.“
Ich will auch nicht behaupten, daß ich es weiß, aber viel liegt ohne Zweifel in dem Umstande: wir haben keine Bündnisse und treiben keine auswärtige Politik, d. h. keine active, sondern wir beschränken uns darauf, die Steine, die in unsern Garten fallen, aufzusammeln und den Schmutz, der uns anfliegt, abzubürsten wie wir können. Wenn ich von Bündnissen rede, so meine ich damit keine Schutz- und Trutz-Bündnisse, denn der Frieden ist noch nicht bedroht; aber alle die Nuancen von Möglichkeit, Wahrscheinlichkeit oder Absicht, für den Fall eines Krieges dieses oder jenes Bündniß schließen, zu dieser oder jener Gruppe gehören zu können, bleiben doch die Basis des Einflusses, den ein Staat heut zu Tage in Friedenszeiten üben kann.
Wer sich in der für den Kriegsfall schwächern Combination befindet, ist nachgiebiger gestimmt, wer sich ganz isolirt, verzichtet auf Einfluß, besonders wenn es die schwächste unter den Großmächten ist. Bündnisse sind der Ausdruck gemeinsamer Interessen und Absichten; ob wir Absichten und bewußte Ziele unsrer Politik überhaupt haben, weiß ich nicht; aber daß wir Interessen haben, daran werden uns Andre schon erinnern. Wir haben aber die Wahrscheinlichkeit eines Bündnisses bisher nur mit denen, deren Interessen sich mit den unsrigen am mannigfachsten kreuzen und ihnen widersprechen, nämlich mit den Deutschen Staaten und Oestreich. Wollen wir damit unsre auswärtige Politik abgeschlossen betrachten, so müssen wir uns auch mit dem Gedanken vertraut machen, in Friedenszeiten unsern Europäischen Einfluß auf 1/17 der Stimmen des engeren Rathes im Bunde reducirt zu sehn und im Kriegsfalle mit der Bundesverfassung in der Hand allein im Taxischen Palais übrig zu bleiben.
Ich frage Sie, ob es in Europa ein Cabinet giebt, welches mehr als das Wiener ein gebornes und natürliches Interesse daran hat, Preußen nicht stärker werden zu lassen, sondern seinen Einfluß in Deutschland zu mindern; ob es ein Cabinet giebt, welches diesen Zweck eifriger und geschickter verfolgt, welches überhaupt kühler und cynischer nur seine eignen Interessen zur Richtschnur seiner Politik nimmt, und welches uns in den Russen und den Westmächten mehr und schlagendere Beweise von gewissenloser Perfidie und Unzuverlässigkeit für Bundesgenossen gegeben hat? Genirt sich denn Oestreich etwa, mit dem Auslande jede seinem Vortheil entsprechende Verbindung einzugehn und sogar die Theilnehmer des Deutschen Bundes vermöge dieser Verbindung offen zu bedrohn? Halten Sie den Kaiser Franz Joseph für eine aufopfernde, hingebende Natur überhaupt und insbesondre für außeröstreichische Interessen? Finden Sie zwischen seiner Buol-Bachschen Regirungsweise und der Napoleonischen vom Standpunkte des „Principes“ einen Unterschied?
Der Träger der letztern sagte mir in Paris, es sei für ihn, qui fais tous les efforts pour sortir de ce système de centralisation trop tendu, qui en dernier lieu a pour pivot un gendarme sécrétaire et que je considère comme une des causes principales des malheurs de la France, sehr merkwürdig zu sehn, wie Oestreich dieselben Anstrengungen mache, um hineinzugerathen. Ich frage noch weiter und bitte Sie, mich in [der] Antwort nicht mit einer ausweichenden Wendung abzufinden: giebt es nächst Oestreich Regirungen, die weniger den Beruf fühlen, etwas für Preußen zu thun, als die Deutschen Mittelstaaten? Im Frieden haben sie das Bedürfniß, am Bunde und im Zollverein Rollen zu spielen, ihre Souveränität an unsern Gränzen geltend zu machen, sich mit v. d. Heydt zu zanken, und im Kriege wird ihr Verhalten durch Furcht oder Mißtrauen für oder gegen uns bedingt, und das Mißtrauen wird ihnen kein Engel ausreden können, so lange es noch Landkarten giebt, auf die sie einen Blick werfen können.
Und nun noch eine Frage: glauben Sie denn und glaubt Se. Majestät der König wirklich noch an den Deutschen Bund und seine Armee für den Kriegsfall? ich meine nicht für den Fall eines Französischen Revolutionskrieges gegen Deutschland im Bunde mit Rußland, sondern in einem Interessenkriege, bei dem Deutschland mit Preußen und Oestreich auf ihren alleinigen Füßen zu stehn angewiesen wären? Glauben Sie daran, so kann ich allerdings nicht weiter discutiren, denn unsre Prämissen wären zu verschieden. Was könnte Sie aber berechtigen, daran zu glauben, daß die Großherzöge von Baden und Darmstadt, der König von Würtemberg oder Baiern den Leonidas für Preußen und Oestreich machen sollten, wenn die Uebermacht nicht auf deren Seite ist und niemand an Einheit und Vertrauen zwischen beiden, Preußen und Oestreich nämlich, auch nur den mäßigsten Grund hat zu glauben? Schwerlich wird der König Max in Fontainebleau dem Napoleon sagen, daß er nur über seine Leiche die Gränze Deutschlands oder Oestreichs passieren werde.
Ganz erstaunt bin ich, in Ihrem Briefe zu lesen, daß die Oestreicher behaupten, sie hätten uns in Neuenburg mehr verschafft als die Franzosen. So unverschämt im Lügen ist doch nur Oestreich; wenn sie gewollt hätten, so hätten sie es nicht gekonnt, und mit Frankreich und England wahrlich keinen Händel um unsertwillen angefangen. Aber sie haben im Gegentheil uns in der Durchmarschfrage genirt, so viel sie konnten, uns verläumdet, uns Baden abwendig gemacht, und jetzt in Paris sind sie mit England unsre Gegner gewesen; ich weiß von den Franzosen und von Kisseleff, daß in allen Besprechungen, wo Hübner ohne Hatzfeldt gewesen ist, und das waren grade die entscheidenden, er stets der erste war, sich dem Englischen Widerspruch gegen uns anzuschließen, dann ist Frankreich gefolgt, dann Rußland. Warum sollte aber überhaupt jemand etwas für uns in Neuenburg thun und sich für unsre Interessen einsetzen? hatte denn jemand von uns etwas dafür zu hoffen oder zu fürchten, wenn er uns den Gefallen that oder nicht? Daß man in der Politik aus Gefälligkeit oder aus allgemeinem Rechtsgefühlt handelt, das dürfen andre von uns, wir aber nicht, von ihnen erwarten.
Wollen wir so isolirt, unbeachtet und gelegentlich schlecht behandelt weiter leben, so habe ich freilich keine Macht, es zu ändern; wollen wir aber wieder zu Ansehn gelangen, so erreichen wir es unmöglich damit, daß wir unser Fundament lediglich auf den Sand des Deutschen Bundes bauen und den Einsturz in Ruhe abwarten. So lange jeder von uns die Ueberzeugung hat, daß ein Theil des Schachbretes uns nach unserm eignen Willen verschlossen bleibt, oder daß wir uns einen Arm prinzipiell festbinden, während jeder andre beide zu unserm Nachtheil benutzt, wird man diese unsre Gemüthlichkeit ohne Furcht und ohne Dank benutzen. Ich verlange ja garnicht, daß wir mit Frankreich ein Bündniß schließen und gegen Deutschland conspiriren sollen; aber ist es nicht vernünftiger, mit den Franzosen, so lange sie uns in Ruhe lassen, auf freundlichem als auf kühlem Fuße zu stehn? Ich will nichts weiter, als andern Leuten den Glauben benehmen, sie könnten sich verbinden, mit wem sie wollten, aber wir würden eher Riemen aus unsrer Haut schneiden lassen, als dieselbe mit Französischer Hülfe vertheidigen. Höflichkeit ist eine wohlfeile Münze, und wenn sie auch nur dahin führt, daß die andern nicht mehr glauben, Frankreichs seien sie gegen uns immer sicher und wir jederzeit hülfsbedürftig gegen Frankreich, so ist das für Friedens-Diplomatie ein großer Gewinn; wenn wir diese Hülfsmittel verschmähn, sogar das Gegentheil thun, so weiß ich nicht, warum wir nicht lieber die Kosten der Diplomatie sparen oder reduciren, denn diese Kaste vermag mit allen Arbeiten nicht zu Wege zu bringen, was der König mit geringer Mühe kann, nämlich Preußen eine angesehene Stellung im Frieden durch den Anschein von freundlichen Beziehungen und möglichen Verbindungen wiederzugeben; nicht minder vermag Se. Majestät durch ein [Zur-]Schautragen kühler Verhältnisse leicht alle Arbeit der Diplomaten zu lähmen; denn was soll ich hier oder einer unsrer andern Gesandten durchsetzen, wenn wir den Eindruck machen, ohne Freunde zu sein oder auf Oestreichs Freundschaft zu rechnen?
Man muß nach Berlin kommen, um nicht ausgelacht zu werden, wenn man von Oestreichs Unterstützung in irgend einer für uns erheblichen Frage sprechen will. Und selbst in Berlin kenne ich doch nachgrade nur einen sehr kleinen Kreis, bei dem das Gefühl der Bitterkeit nicht durchbräche, sobald von unsrer auswärtigen Politik die Rede ist. Unser Rezept für alle Uebel ist, uns an die Brust des Grafen Buol zu werfen und ihm unser brüderliches Herz auszuschütten. Ich erlebte in Paris, daß ein Graf So und so gegen seine Frau auf Scheidung klagte, nachdem er sie, eine ehemalige Kunstreiterin, zum 24. Male im flagranten Ehebruch betroffen hatte; er wurde als ein Muster von galantem und nachsichtigem Ehemann von seinem Advocaten vor Gericht gerühmt; aber gegen unsern Edelmuth mit Oestreich kann er sich doch nicht messen.
Unsre innern Verhältnisse leiden unter ihren eignen Fehlern kaum mehr, als unter dem peinlichen und allgemeinen Gefühl unsres Verlustes an Ansehn ihm Auslande und der gänzlich passiven Rolle unsrer Politik. Wir sind eine eitle Nation; es ist uns schon empfindlich, wenn wir nicht renommiren können, und einer Regierung, die uns nach Außen hin Bedeutung giebt, halten wir vieles zu Gute und lassen uns viel gefallen dafür, selbst im Beutel. Aber wenn wir uns fürs Innre sagen müssen, daß wir mehr durch unsre guten Säfte die Krankheiten ausstoßen, welche unsre ministeriellen Aerzte uns einimpfen, als daß wir von ihnen geheilt und zu gesunder Diät angeleitet würden, so sucht man im Auswärtigen vergebens nach einem Trost dafür.
Sie sind doch, verehrtester Freund, au fait von unsrer Politik; können Sie mir nun ein Ziel nennen, welches dieselbe sich etwa vorgesteckt hat, auch nur einen Plan auf einige Monate hinaus, grade rebus sic stantibus, weiß man da, was man eigentlich will? weiß das irgend jemand in Berlin, und glauben Sie, daß bei den Leitern eines der andern großen Staaten dieselbe Leere an positiven Zwecken und Ideen vorhanden ist? Können Sie mir ferner einen Verbündeten nennen, auf welchen Preußen zählen könnte, wenn es heut grade zum Kriege käme, oder der für uns spräche bei einem Anliegen, wie etwa das Neuenburger, oder der für uns irgend etwas thäte, weil er auf unsern Beistand rechnet oder unsre Feindschaft fürchtet?
Wir sind die gutmüthigsten, ungefährlichsten Politiker, und doch traut uns eigentlich niemand, wir gelten wie unsichere Genossen und ungefährliche Feinde, ganz als hätten wir uns im Aeußern so betragen und wären im Innern so krank wie Oestreich. Ich spreche nicht von der Gegenwart; aber können Sie mir einen positiven Plan (abwehrende genug), eine Absicht nennen, die wir seit dem Radowitzischen Dreikönigsbündniß in auswärtiger Politik gehabt haben? Doch, den Jahdebusen, der bleibt aber bisher ein todtes Wasserloch, und den Zollverein werden wir uns von Oestreich ganz freundlich ausziehn lassen, weil wir nicht den Entschluß haben, einfach nein zu sagen. Ich wundre mich, wenn es bei uns noch Diplomaten giebt, denen der Muth, einen Gedanken zu haben, denen die sachliche Ambition, etwas leisten zu wollen, nicht schon erstorben ist, und ich werde mich ebenso gut wie meine Collegen darin finden, einfältig meine Instruction zu vollziehn, den Sitzungen beizuwohnen und mich der Theilnahme für den allgemeinen Gang unsrer Politik zu entschlagen; man bleibt gesünder dabei und verbraucht weniger Tinte.
Sie werden wahrscheinlich sagen, daß ich aus dépit, weil Sie nicht meiner Meinung sind, schwarz sehe und raisonnire wie ein Rohrspatz. Aber ich würde wahrlich ebensogern meine Bemühungen an die Durchführung fremder Ideen wie eigner setzen, wenn ich überhaupt welche fände, die man zum Nutz und Frommen unsrer Politik ins Werk zu setzen beabsichtigte. So weiter zu vegetiren, dazu bedürfen wir eigentlich des ganzen Apparates unsrer Diplomatie nicht. Die Tauben, die uns gebraten anfliegen, entgehn uns ohnehin nicht; oder doch, denn wir werden den Mund schwerlich dazu aufmachen, falls wir nicht grade gähnen. Mein Streben geht ja nur dahin, daß wir solche Dinge zulassen und nicht von uns weisen, welche geeignet sind, bei den Cabinetten in Friedenszeit den Eindruck zu machen, daß wir uns mit Frankreich nicht schlecht stehn, daß man auf unsre Beistandsbedürftigkeit gegen Frankreich nicht zählen und uns deßhalb drücken darf und daß uns, wenn man unwürdig mit uns umgehn will, alle Bündnisse offenstehn.
Wenn ich nun melde, daß diese Vortheile gegen Höflichkeit und gegen den Schein der Reciprocität zu haben sind, so erwarte ich, daß man mir entweder nachweist, es seien keine Vortheile, es entspreche vielmehr unsern Interessen besser, wenn fremde und Deutsche Höfe berechtigt sind, von der Annahme auszugehn, daß wir gegen Westen unter allen Umständen feindlich gerüstet sein müssen und Bündnisse, eventuell Hülfe, dagegen bedürfen, und wenn sie diese Annahme als Basis ihrer gegen uns gerichteten politischen Operationen ausbeuten. Oder ich erwarte, daß man andre Pläne und Absichten hat, in deren Combination der Anschein eines guten Vernehmens mit Frankreich nicht paßt.
Ich weiß nicht, ob die Regierung einen Plan hat (den ich nicht kenne), ich glaube es nicht; wenn man aber diplomatische Annäherungen einer großen Macht nur deshalb von sich abhält und die politischen Beziehungen zweier großer Mächte nur danach regelt, ob man Antipathien oder Sympathien für Zustände und Personen hat, die man doch nicht ändern kann und will, so drücke ich mich mit Zurückhaltung aus, wenn ich sage: ich habe dafür kein Verständniß als Diplomat und finde mit Annahme eines solchen Systems in auswärtigen Beziehungen das ganze Gewerbe der Diplomatie bis auf das Niveau des Consularwesens hinunter überflüssig und thatsächlich cassirt.
Sie sagen mir, „der Mann ist unser natürlicher Feind, und daß er es ist und bleiben muß, wird sich bald zeigen.“ Ich könnte das bestreiten, oder mit demselben Recht sagen, Oestreich, England sind unsre Feinde, und daß sie es sind, zeigt sich schon längst, bei Oestreich natürlicher, bei England unnatürlicher Weise. Aber ich will das auf sich beruhn lassen und annehmen, Ihr Satz wäre richtig, so kann ich es auch dann noch nicht für politisch halten, unsre Befürchtungen schon im Frieden von Andern und von Frankreich selbst erkennen zu lassen, sondern finde es, bis der von Ihnen vorhergesehne Bruch wirklich eintritt, immer noch nützlich, die Leute glauben zu lassen, daß ein Krieg gegen Frankreich uns nicht nothwendig über kurz oder lang bevorsteht, daß er wenigstens nichts von Preußens Lage Unzertrennliches, daß die Spannung gegen Frankreich nicht ein organischer Fehler, eine angeborne schwache Seite unsrer Natur ist, auf die jeder Andre mit Sicherheit speculiren kann. Sobald man uns für kühl mit Frankreich hält, wird auch der Bundescollege hier kühl für mich und hat in seiner Haltung unwillkührlich den Ausdruck des Gedankens: Preußen kann sehr froh sein, wenn wir ihm den Rhein vertheidigen helfen, und den Hintergedanken: daß es geschieht, ist sehr unwahrscheinlich. Sobald wir dagegen gut mit Frankreich zu stehn scheinen, nimmt der collegialische Blick den Ausdruck achtungsvollen Wohlwollens für mich an, und der Mund fließt über von dem berechtigten Einflusse Preußens in Deutschland. Das ist so übel wie möglich, aber wir müssen mit den Realitäten wirthschaften und nicht mit Fictionen.
Nach Berlin zur Salzsteuer zu kommen wurde ich sowohl von einer Anzahl von Kammergliedern als auch später von Manteuffel aufgefordert; erstre schrieben mir, daß die Mehrheit zwar ohnehin feststehe, daß es aber wünschenswerth sei, mein Zeugniß mit in die Wage zu legen. Manteuffels Aufforderung erhielt ich in Paris am 21. v. M. durch Hatzfeldt; am 23. war die Sitzung, und ich konnte, wenn ich direct nach Berlin gefahren wäre, am Morgen vor derselben eintreffen; es hätte aber selbst dann keinen Sinn gehabt, wenn ich nach Befehl hätte stimmen und die Ziffer der 21 und 22 bringen wollen. Dieses Zusammenkratzen der Stimmen aus Wien, Haag, Paris finde ich unbegreiflich, da man doch in Berlin dasselbe über das Schicksal der Vorlage wissen konnte, was ich in Paris wußte.
Ich habe mehre Audienzen bei dem Kaiser Napoleon gehabt, und verschiedne dîners am Hofe. Ich hatte Ihnen einen 3 Bogen langen Brief über meine Eindrücke geschrieben, habe ihn aber nach Empfang des Ihrigen verbrannt und diesen dafür substituirt, da das, was ich sagte, von Ihrer voreingenommnen Position abgelaufen wäre, wie Wasser vom Entenflügel. Ich schütte in diesem Briefe meine Empfindungen aus, aber ich kann mit Ihnen die Frage nicht sachlich eingehend discutiren, weil ich gegen persönliche Empfindungen nicht aufkommen kann und Sie die politische Anschauung denselben, wie mir scheint, unterordnen. Ich bin mir sonst zu vieler gemeinsamer Grundlagen mit Ihnen bewußt, um nicht des gegenseitigen fernern Verständnisses auf dem größern Gebietsantheile geistiger Interessen sicher zu bleiben; aber in dem einen Punkt haben wir abweichendes Maß und Gewicht für die Pflichten des Berufs, den Gott mir, meinem Vaterlande gegenüber, wie ich glaube, auferlegt hat, indem er mir ohne mein Zuthun ein Gewerbe anwies, welches ich mir nicht eigenmächtig gewählt habe. Wenn ich dasselbe nur äußerlich bekleide und thatsächlich leeres Stroh dresche, so leide ich am Gewissen und fühle mich deplacirt, ohne in der Befriedigung äußerlichen Ehrgeizes Ersatz dafür zu finden. Ich erwähne das als Erklärung dafür, daß ich nicht mir und andern Arbeit und Unruhe spare und lieber einfach die Nummern abmache, die mir dienstlich zugehn.
Nur zwei Worte will ich noch von Neuenburg sagen. Sie meinen, wenn wir die Neuenburger einfach des Eides entließen, so sollten sich die Mächte nachher mit der Schweiz über die Bedingungen einigen und der König unberührt bleiben. Warum sollten die Mächte das aber thun? es fehlt ihnen an jedem Motiv, sich darum zu bemühn und ihrerseits das Schicksal unsrer Freunde in Neuenburg sicher zu stellen. Sie werden sich vielmehr ärgern, daß wir uns dem Spruche ihrer gemeinsam ausgedüftelten Weisheit nicht fügen wollen, und werden es ganz gern sehn, wenn die Schweiz unsre Anhänger kneift, daß sie recht laut schreien, und schließlich von uns erlangen, was man will, wenn wir durch die Leiden der Royalisten unter den Druck eines neuen Ehrenpunktes gesetzt werden, ohne an Selbshülfe denken zu können. Werden wir dann noch dieselben Bedingungen erlangen können? Und selbst wenn „unser natürlicher Feind“ alsdann aus eignem Antriebe sich der bedrängten Conservativen annähme, soweit es ihm England gestattete, wären wir dabei als Zuschauer in ehrenvoller Lage? Die Neuenburger selbst werden es uns wenig danken, wenn wir sie auf diese Chance hin ohne Amnestie und Sicherheit lassen.
Ich weiß nicht, ob es noch dabei bleibt, daß der Prinz Napoleon in etwa 8 Tagen nach Berlin kommt; bei der Stimmung, die ich dort nach Ihrem Schreiben voraussetze, wäre es mir lieber, es unterbliebe, denn es wird ihm dort nicht verborgen bleiben können, daß er ein unwillkommner Gast ist. Politische Aufträge von Paris erhält er nicht, und wenn er Politik bei uns macht, so ist es seine eigne; man hat mir das ausdrücklich gesagt. Der Kaiser Napoleon sieht übrigens sehr wohl aus und ist viel stärker geworden seit 55. Die Blasenkrankheit, die man ihm gerüchteweise beilegt, kann er deßhalb nicht wohl haben, denn fett wird man dabei nicht. Von Attentaten hörte man unter den gobe-mouches in Paris täglich die absurdesten erzählen, aber alles vollständig erfunden, meist von Polizeiagenten fremder Länder, die ihr Brot verdienen wollen. Die Geschichten sind fast immer nach Oertlichkeit und Umständen an sich unmöglich, die mir erzählt worden sind. Ich wäre recht gern nach Berlin gekommen, um mündlich mehr Politisches über Paris zu melden; aber es ist wohl besser, daß ich als Schuster beim Leisten bleibe. Als ordonnanzmäßige Stimme zur Salzsteuer konnte ich mich nicht citiren lassen, und außerhalb dieses meines Votums wäre ich nichts nütz gewesen. Verzeihn Sie diesen endlosen Tintenerguß und sehn Sie einen Beweis meiner Liebe und Verehrung darin, daß ich mich so weitläufig vertheidige, wenn ich andrer Meinung bin wie Sie. Leben Sie wohl, Gott wolle Ihrem häuslichen Kummer in Gnaden steuern.
Stets der Ihrige.