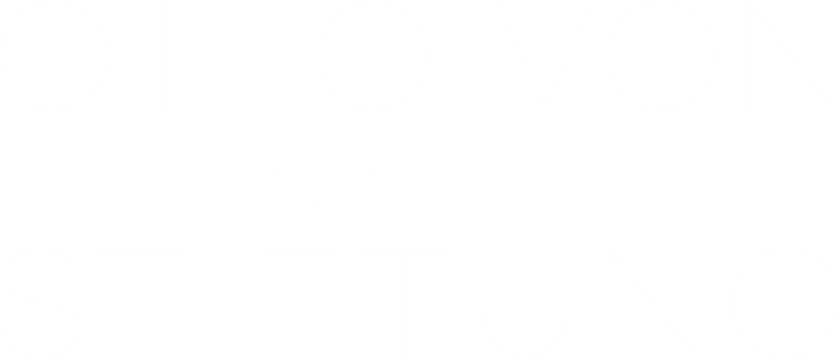Brief an Heinrich von Puttkamer, Stettin, ca. 21. Dezember 1846
Verehrtester Herr von Puttkamer
Ich beginne dieses Schreiben damit, daß ich Ihnen von vorn herein seinen Inhalt bezeichne; es ist eine Bitte um das Höchste, was Sie auf dieser Welt zu vergeben haben, um die Hand Ihrer Fräulein Tochter.
Ich verhehle mir nicht, daß ich dreist erscheine, wenn ich, der ich erst neuerlich, und durch sparsame Begegnung Ihnen bekannt geworden bin, den stärksten Beweis von Vertrauen beanspruche, den Sie einem Mann geben können. Ich weiß aber, daß ich, auch abgesehn von allen Hindernissen in Raum und Zeit, welche Ihnen die Bildung eines Urtheils über mich erschweren können, durch mich selbst niemals im Stande sein kann, Ihnen solche Bürgschaften für die Zukunft zu geben, daß sie den Einsatz eines so theuren Pfandes von Ihrer Seite rechtfertigen würden, wenn Sie nicht durch Vertrauen auf Gott das ergänzen, was das Vertrauen auf Menschen nicht leisten kann.
Was ich selbst dazu thun kann, beschränkt sich darauf, daß ich Ihnen mit rückhaltloser Offenheit über mich selbst Auskunft gebe, soweit ich mir selber klar geworden bin. Über mein äußerliches Auftreten wird es Ihnen leicht sein, Nachricht durch Andre zu erhalten; ich begnüge mich daher mit einer Darstellung meines innern Lebens, welches jenem zu Grunde lag, und besonders meines Standpunktes zum Christenthum. Ich muß dazu weit ausholen. Ich bin meinem elterlichen Hause in frühester Kindheit fremd und nie wieder völlig darin heimisch geworden, und meine Erziehung wurde von Hause her aus dem Gesichtspunkt geleitet, daß alles der Ausbildung des Verstandes und dem frühzeitigen Erwerb positiver Kenntnisse untergeordnet blieb. Nach einem unregelmäßig besuchten und unverstandenen Religionsunterricht, hatte ich bei meiner Einsegnung durch Schleiermacher, an meinem 16ten Geburtstage keinen andern Glauben, als einen nackten Deismus, der nicht lange ohne pantheistische Beimischungen blieb. Es war ungefähr um diese Zeit, daß ich, nicht aus Gleichgültigkeit, sondern in Folge reiflicher Überlegung, aufhörte, jeden Abend, wie ich von Kindheit her gewohnt gewesen war, zu beten, weil mir das Gebet mit meiner Ansicht von dem Wesen Gottes in Widerspruch zu stehn schien, indem ich mir sagte, daß entweder Gott selbst, nach seiner Allgegenwart, Alles, also auch jeden meiner Gedanken und Willen, hervorbringe, und so gewissermaßen durch mich zu Sich Selbst bete, oder daß, wenn mein Wille ein von dem Gottes unabhängiger sei, es eine Vermessenheit enthalte, und einen Zweifel an der Unwandelbarkeit, also auch an der Vollkommenheit, des göttlichen Rathschlusses, wenn man glaube, durch menschliche Bitten darauf Einfluß zu üben.
Noch nicht voll 17 Jahr alt ging ich zur Universität nach Göttingen. In den nächsten 8 Jahren sah ich mein elterliches Haus selten; mein Vater ließ mich nachsichtig gewähren, meine Mutter tadelte mich aus der Ferne, wenn ich meine Studien und Berufsarbeiten vernachläßigte, wohl in der Meinung, daß sie das Übrige höherer Führung überlassen müsse. Sonst blieben mir Rath und Lehre Andrer buchstäblich fern; der Zwang der Schule war gefallen, und die Stimme meines Gewissens, von keinem Glauben getragen, verhallte im Sturm ungezähmter Leidenschaften. So, mit keinem andern Zügel, als etwa dem der gesellschaftlich conventionellen Rücksichten, stürzte ich mich blind in das Leben hinein, gerieth, bald verführt, bald Verführer, in schlechte Gesellschaften jeder Art, und hielt, auch in den bewußtesten Augenblicken, alle Sünden für erlaubt, sobald sie mir die Rechte Andrer, nach ihrer laxesten Auslegung, nicht zu beeinträchtigen schienen. Wenn mich in dieser Periode Studien, die mich der Ehrgeiz zu Zeiten mit Eifer treiben ließ, oder Leere und Überdruß, die unvermeidlichen Begleiter meines Treibens, dem Ernst des Lebens und der Ewigkeit näherten, so waren es Philosophen des Alterthums, unverstandene Hegelsche Schriften, und vor Allem Spinoza’s anscheinend mathematische Klarheit, in denen ich Beruhigung über das suchte, was menschlichem Verstande nicht faßlich ist.
Zu anhaltendem Nachdenken hierüber wurde ich aber erst durch die Einsamkeit gebracht, als ich nach dem Tode meiner Mutter vor 6 bis 7 Jahren, nach Kniephof zog. Wenn hier anfangs meine Ansichten über das was sündlich sei, und in Folge dessen meine Handlungsweise, sich nicht erheblich änderte, so fing doch bald die innre Stimme an, in der Einsamkeit hörbarer zu werden, und mir manches als Unrecht darzustellen, was ich früher für erlaubt gehalten hatte. Immer indeß blieb mein Streben nach Erkenntnis in den Cirkel des Verstandes gebannt, und führte mich, unter Lesung von Schriften wie die von Strauß, Feuerbach, Bruno Bauer, nur tiefer in die Sackgasse des Zweifels. Es stellte sich bei mir fest, daß Gott dem Menschen die Möglichkeit der Erkenntnis versagt habe, daß es Anmaßung sei, wenn man den Willen und die Pläne des Herrn der Welt zu kennen behaupte, daß der Mensch in Ergebenheit erwarten müsse, wie sein Schöpfer im Tode über ihn bestimmen werde, als durch das Gewissen, welches er nur als Fühlhorn durch das Dunkel der Welt mitgegeben habe.
An eine geoffenbarte Religion schien es mir unmöglich jemals Glauben zu gewinnen; der Bibel legte ich keine beweisende Kraft bei, sie war für mich ein Buch aus Menschenhänden, dessen Lesung mir nur stets neuen Stoff zu Kritik und Zweifel gab. Zu Gott zu beten schien mir noch aus denselben Gründen widersinnig, aus denen ich es früher aufgegeben hatte. Daß ich bei diesem Glauben nicht Frieden fand, brauche ich nicht zu sagen; ich habe manche Stunde trostloser Niedergeschlagenheit mit dem Gedanken zugebracht, daß mein und andrer Menschen Dasein zwecklos und unersprießlich sei, vielleicht nur ein beiläufiger Ausfluß der Schöpfung, der entsteht und vergeht, wie Staub vom Rollen der Räder; die Ewigkeit, die Auferstehung, war mir ungewiß, und doch sah ich in diesem Leben nichts, was mir der Mühe werth schien, es mit Ernst und Kraft zu erstreben. Ich suchte Befriedigung im Treiben der Geschäfte, eigner und fremder, durch Reisen, trat wieder in Staatsdienst, ohne das Gesuchte zu finden. –
Etwa vor 4 Jahren kam ich, seit meiner Schulzeit zuerst wieder, in nähere Berührung mit Moritz Blanckenburg, und fand an ihm, was ich bis dahin im Leben nicht gehabt hatte, einen Freund; aber der warme Eifer seiner Liebe suchte vergeblich mir durch Überredung und Disputation das zu geben, was mir fehlte, den Glauben. Durch Moritz wurde ich indeß mit dem Triglafer Hause und dessen weiterem Kreise bekannt, und fand darin Leute, vor denen ich mich schämte, daß ich mit der dürftigen Leuchte meines Verstandes Dinge hatte untersuchen wollen, welche so überlegne Geister mit kindlichem Glauben für wahr und heilig annahmen. Ich sah, daß die Angehörigen dieses Kreises, in ihren äußeren Werken, fast durchgehends Vorbilder dessen waren, was ich zu sein wünschte. Daß Zuversicht und Friede bei ihnen wohnte, war mir nicht überraschend; denn daß diese Begleiter des Glaubens seien, hatte ich nie bezweifelt. Aber der Glaube läßt sich nicht geben und nehmen, und ich meinte in Ergebung abwarten zu müssen, ob er mir werden würde. Ich fühlte mich bald heimisch in jenem Kreise, und bei Moritz und seiner Frau, die mir theuer wurde, wie je eine Schwester ihrem Bruder, empfand ich ein Wohlsein, wie es mir bisher fremd gewesen war, ein Familienleben, das mich mit einschloß, fast eine Heimath. –
Ich wurde inzwischen von Ereignissen berührt, bei denen ich nicht handelnd betheiligt war, und die ich als Geheimnisse Andrer nicht mittheilen darf, die aber erschütternd auf mich wirkten. Ihr factisches Resultat war, daß das Bewußtsein der Flachheit und des Unwerthes meiner Lebensrichtung in mir lebendiger wurde als je, die gute Meinung Andrer von mir mich drückte und beschämte, und ich bittre Reue über mein bisheriges Dasein empfand. Durch Rath Andrer wie durch eignen Trieb wurde ich darauf hingeführt, consequenter und mit entschiedner Gefangenhaltung einstweilen des eignen Urtheils, in der Schrift zu lesen. Was in mir sich regte, gewann Leben, als sich, bei der Nachricht von dem tödlichen Erkranken unsrer verstorbenen Freundin in Cardemin, das erste inbrünstige Gebet, ohne Grübeln über die Vernünftigkeit desselben, von meinem Herzen losriß, verbunden mit schneidendem Wehgefühl über meine eigne Unwürdigkeit zu beten, und mit Thränen wie sie mir seit den Tagen meiner Kindheit fremd gewesen waren. Gott hat mein damaliges Gebet nicht erhört, aber er hat es auch nicht verworfen, denn ich habe die Fähigkeit ihn zu bitten nicht wieder verloren, und fühle, wenn nicht Frieden, doch Vertrauen und Lebensmuth in mir, wie ich sie sonst nicht mehr kannte. Durchdrungen von der Erkenntnis, durch mich selbst der Sünde und Verkehrtheit nicht ledig werden zu können, fühle ich mich doch in dieser Erkenntnis nicht muthlos und niedergeschlagen, wie früher ohne dieselbe, weil der Zweifel an einem ewigen Leben von mir gewichen ist, und weil ich Gott täglich mit bußfertigem Herz bitten kann, mir gnädig zu sein um Seines Sohnes willen, und in mir Glauben zu wecken und zu stärken. Mit diesem Gebet bin ich auch entschlossen, zum heiligen Abendmahl zu gehn, was ich seit meiner Einsegnung vermieden habe, weil es mir Lästerung, oder doch Leichtfertigkeit zu sein schien, es mit den Gedanken zu nehmen, die ich damit verbinden konnte.
Welchen Werth Sie dieser erst zwei Monat alten Regung meines Herzens beilegen werden, weiß ich nicht; nur hoffe ich, soll sie, was auch über mich beschlossen sein mag, unverloren bleiben; eine Hoffnung, die ich Ihnen nicht anders habe bekräftigen können, als durch unumwundene Offenheit und Treue in dem was ich Ihnen, und sonst noch niemandem, hier vorgetragen habe, mit der Überzeugung, daß Gott es den Aufrichtigen gelingen lasse.
Ich enthalte mich jeder Betheurung über meine Gefühle und Vorsätze in Bezug auf Ihre Fräulein Tochter, denn der Schritt den ich thue, spricht lauter und beredter davon, als Worte vermögen. Auch mit Versprechungen für die Zukunft kann Ihnen nicht gedient sein, da Sie die Unzuverläßigkeit des menschlichen Herzens besser kennen als ich, und meine einzige Bürgschaft für das Wohl Ihrer Fräulein Tochter liegt nur in meinem Gebet um den Segen des Herrn. Historisch nur bemerke ich, daß, nachdem ich Fräulein Johanna wiederholt in Cardemin gesehn hatte, nach unsrer gemeinschaftlichen Reise in diesem Sommer, ich nur darüber in Zweifel gewesen bin, ob die Erreichung meiner Wünsche mit dem Glück und Frieden Ihrer Fräulein Tochter sein werde, und ob mein Selbstvertrauen nicht größer sei als meine Kräfte, wenn ich glaubte, daß sie in mir finden könne, was sie in ihrem Manne zu suchen berechtigt sein würde. In der jüngsten Zeit ist aber, mit dem Vertrauen auf Gottes Gnade auch der Entschluß in mir fest geworden, den ich jetzt ausführe, und ich habe in Zimmerhausen nur deshalb gegen Sie geschwiegen, weil ich mehr zu sagen hatte, als ich mündlich zusammenfassen kann.
Vollständiger Aufrichtigkeit wegen glaube ich noch anführen zu müssen, daß ich im Jahre 1841 bereits verlobt gewesen bin, mit Fräulein von Puttkammer auf Pansin; ein Verhältnis, das nach etwa halbjähriger Dauer, ohne Angabe der Gründe, durch den Willen der Mutter gelöst wurde, welche die Sache von Hause aus ungern gesehen hatte, und augenscheinlich kein Vertrauen zu mir fassen konnte. Die sinnlichere Natur unsrer Neigung erwies sich nicht stark genug, um dieses Hinderniß zu überdauern.
Bei der ernsten Wichtigkeit der Sache, und der Größe des Opfers, welches Sie und Ihre Frau Gemahlin durch die Trennung von Ihrer Fräulein Tochter dereinst zu bringen haben würden, kann ich kaum hoffen, daß Ihre Entscheidung ohne Weiteres günstig für meinen Antrag ausfallen werde, und bitte nur, daß Sie mir die Gelegenheit nicht versagen wollen, mich über solche Gründe, die Sie zu einer abschlägigen Antwort bestimmen könnten, meinerseits zu erklären, ehe Sie eine definitive Ablehnung aussprechen.
Es ist gewiß noch vieles, was ich in diesem Schreiben nicht oder nicht vollständig genug gesagt habe, und bin ich natürlich bereit Ihnen über Alles, was Sie zu wissen verlangen werden, genaue und ehrliche Auskunft zu geben. Das Wichtigste glaube ich gesagt zu haben.
Ich bitte Sie, Ihrer Frau Gemalin meine ehrerbietige Empfehlung darzubringen, und die Versicherung meiner Liebe und Hochachtung mit Wohlwollen aufzunehmen.
Bismarck