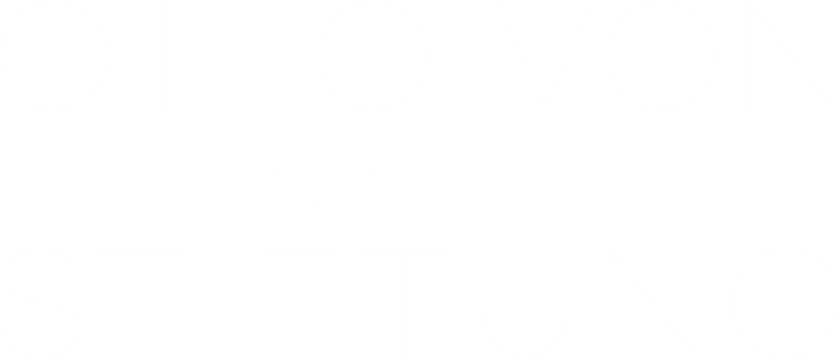Brief an den Vater Ferdinand von Bismarck, Greifswald, 29. September 1838
Lieber Vater
Theodor [von Bismarck-Bohlen] wird Dir gesagt haben, daß er mich gesund und munter hier verlassen, und mein herzlichster Wunsch ist, daß er Dich in demselben Zustande gefunden hat und daß Mutters Gesundheit so in der Besserung fortgeschritten ist, wie die letzte Nachricht, welche ich bei Lienchen [Karoline von Malortie] von ihr fand, mich hoffen ließ. Ich bin zwar nicht der Mann, der Andern über Briefschreiben Vorhaltungen machen sollte; aber ich kann doch nicht verhehlen, daß mir grade in diesem Augenblick, wo der Doctor so glückliche Hoffnung zu einer bleibenden Aenderung in Mutters Befinden gegeben hat, die Zeit sehr lang wird, während welcher ich keine Nachricht über die Erfüllung derselben erhalten habe, und ich warte mit Sehnsucht darauf, da es mir immer noch im Sinne liegt, wie leidend Mutter war, grade als ich von ihr Abschied nahm. Es würde eine große Freude für mich sein, nach so langer Zeit wieder einmal einige Zeilen von Mutters eigner Hand zu sehn. Jedenfalls werde ich am nächsten Mittwoch durch Theodor nähere Nachrichten bekommen, wenn ich bis dahin keinen Brief erhalten sollte. –
Daß ich bis zur Rückkehr der Jäger von Stargard hier ganz ruhig lebe, habe ich Euch schon geschrieben; die Zeit, wo ich nicht in Carlsburg gewesen bin, bringe ich hier ganz einsam und regelmäßig zu, denn Leute, mit denen ich eigentlich umginge, habe ich nicht, und das ist recht gut, ich befinde mich dabei behaglicher als je und kann ungestört studiren, wozu ich in Potsdam wegen meiner Freunde und wegen des Dienstes nie gekommen wäre. Hauptsächlich beschäftige ich mich vorläufig mit Chemie, worin ich mit einem Mediciner, der sich zum Examen vorbereitet, täglich einige Stunden arbeite.
In der Nähe habe ich mir einige Wirtschaften angesehn, die hier durchschnittlich in einem fast musterhaften Zustande sind; aber beinah lediglich Ackerwirthschaften; auch hört man bei Tisch im Deutschen Hause alle die wohlbeleibten Figuren mit rothen Gesichtern, dicken Händen und beneidenswerthem Appetit, die sich täglich zu 6 bis 8 und mehren dort einfinden, ausschließlich nur von Ackerbau und Kornhandel sprechen; obgleich sie alle erschrecklich schreien und heftig dabei gestikuliren, verstehe ich doch selten, was sie sagen, da man allgemein platt spricht, und sehr schnell, so daß ich nur mitunter etwas wie Raps, Hafer, Arbsen, Sämaschine, Dröschen, pummersche Last und Berliner Schäpel unterscheide; das höre ich dann mit sehr verständiger Miene, denke darüber nach und träume Nachts von Dreeschhafer, Mist und Stoppelroggen.
In Eldena ist noch immer alles verreist, die Lehrer wie die meisten Schüler. Der Director der Akademie, Schulz, ist zugleich Dirigent der dortigen ziemlich bedeutenden Ackerwirthschaft; letztre ist aber thörichter Weise außer Verbindung mit der Akademie, so daß es den Akademikern zwar freisteht, sie sich anzusehn, wenn sie Lust haben, sie aber zu ihrer Instruction nicht weiter benutzt wird. Die Zahl der Zöglinge, einige 90, ist zu groß, um den Unterricht so mit der Praxis zu verbinden, wie es eigentlich im Plane des Instituts lag. Die Sache läßt sich erst sicher beurtheilen, wenn der Unterricht wieder anfängt oder ich wenigstens mit dem Director gesprochen habe; bis jetzt glaube ich aber kaum, daß ich dort in den Hörsälen mehr lernen werde als aus guten Büchern. Dagegen nimmt der Director auch einige Lehrlinge in die Wirthschaft selbst auf; dieselbe wird vortrefflich geleitet; Schulz hat einen großen Theil des Landes, der kaltgrundig und sumpfig war, zu Grundstücken gemacht, die jetzt für die besten in der Gegend gelten, so daß er in Winterfrüchten das 15te und 16te Korn geerntet hat; der frische Klee steht überall wie eine Bürste, und bei großem Scheunenraum sieht man auf dem Felde 4 oder 5 haushohe Miethen stehn. Ziegelei, Brennerei und Brauerei sind auch da; die beiden letztem aber in diesem Jahre theilweis abgebrannt, und ist es deßhalb die Frage, ob sie zu diesem Winter wieder in Gang kommen werden. Als Lehrling bei Schulz könnte man gewiß viel lernen; es ist nur die Frage, ob er mich annimmt und ob er nicht ein unverhältnißmäßiges Lehrgeld nimmt.
Eldena ist übrigens eine gute halbe Meile von hier, und im Winter wird der Weg bodenlos sein; da ich nun wegen des Militärs in der Stadt wohnen muß, so werde ich erst sehn, wie ich es möglich mache, daß ich 1 oder 2 Collegia, die mir augenblicklich die nützlichsten sind, dort höre; sonst werde ich versuchen, hier an der Universität und durch häusliches Studium, und, wenn ich Urlaub auf längere Zeit bekommen kann, in irgend einer nahen Wirthschaft, für meine Zwecke zu profitiren, was ich kann. –
Es ist recht schade, daß ich nicht noch länger habe bei der Mutter bleiben können, anstatt hier diese 4 Wochen zuzubringen; aber sie hatten mir in Potsdam die Hölle so heiß gemacht, um mich möglichst zu beeilen, daß ich zur Abtheilung käme; der Cpt. Röder meinte sogar, ich müßte gleich nachmarschiren, wenn kein Offizier hier zurückgeblieben wäre, der es anders beföhle, so daß ich schon fürchtete, man würde mich hier gleich übel empfangen, weil ich nicht eher eingetroffen war. Statt dessen erhielt ich auf meine Anfrage einen sehr artigen Brief von Hauptmann von Portatius, worin er mir aus freien Stücken bis zu seiner Rückkehr Urlaub ertheilt. Gleich wieder nach Berlin zu reisen, war sehr kostspielig, und ich will dafür lieber, wenn es möglich ist, zu Weihnachten hinkommen. –
Du hattest gewünscht, das Concept von meiner Antwort auf Lienchens Brief zu sehn; es ist aber zu sehr durcheinander geschrieben, als daß Du Dich daraus vernehmen könntest; ich will Dir daher lieber von dem Wesentlichsten der ziemlich langen Epistel eine Abschrift geben, die ich Dich bitte auch Bernhard gelegentlich mitzutheilen; denn er hat mir einen ähnlichen Brief wie Lienchen geschrieben, und ich habe ihn in der Antwort, um nicht dreimal dasselbe zu schreiben, der Hauptsache nach auf diese Abschrift meines Briefes verwiesen. Derselbe beginnt mit einer Reihe von Entschuldigungen, Bedauern und Danksagungen, die Dich weniger interessiren werden, und ich werde nur das wiedergeben, was speziell die Vertheidigung meiner Ansichten zum Zweck hat:
… – daß für mich die Nothwendigkeit, ein Landjunker zu werden, nicht vorhanden war, ist auch meine Meinung; auf der andern Seite werden Sie aber, obgleich ich Ihnen beträchtlich bürokratische Ansichten zutraue, nicht im Ernste behaupten, daß die einem Jeden gegen sein Vaterland obliegenden Pflichten von mir grade fordern sollten, daß ich Administrativ-Beamter werde; vielmehr glaube ich diesen Pflichten vollständig zu genügen, wenn ich innerhalb des beliebig von mir gewählten Berufs alles das thue, was man von einem sein Vaterland liebenden Staatsbürger erwarten darf.
Ich glaubte deshalb mit voller Unabhängigkeit hinsichtlich meines Berufs die Wahl treffen zu können, die mir bei meinen Neigungen und Verhältnissen die vernünftigste zu sein schien. Daß mir von Hause aus die Natur der Geschäfte und der dienstlichen Stellung unsrer Staatsdiener nicht zusagt, daß ich es nicht unbedingt für ein Glück halte, Beamter und selbst Minister zu sein, daß es mir ebenso respectabel und unter Umständen nützlicher zu sein scheint, Korn zu bauen als administrative Verfügungen zu schreiben, daß mein Ehrgeiz mehr danach strebt, nicht zu gehorchen, als zu befehlen: das sind facta, für die ich außer meinem Geschmack keine Ursache anzuführen weiß, indessen, dem ist so. Von allen Gründen, welche mich hätten veranlassen können, diese Abneigung zu bekämpfen, wäre wohl der würdigste gewesen der Wunsch, umfassender auf das Wohl meiner Mitbürger zu wirken, als es einem Privatmanne möglich ist. Abgesehn davon, ob ich wirklich edel genug denke, um meine Kräfte mehr auf die Beförderung des Wohls Andrer als auf die des eignen zu verwenden, bin ich, selbst bei der unbescheidensten Meinung von meinen Fähigkeiten, der Ansicht, daß es für das Wohlergehn der Einwohner von Preußen keinen Unterschied machen würde, ob ich oder ein Andrer von den vielen tüchtigen Leuten, die dieses Ziel erstreben, der Regirung einer Provinz angehöre oder vorstehe.
Die Wirksamkeit des einzelnen Beamten bei uns ist wenig selbstständig, auch die des höchsten, und bei den andern beschränkt sie sich schon wesentlich darauf, die administrative Maschinerie in dem einmal vorgezeichneten Geleise fortzuschieben. Der preußische Beamte gleicht dem Einzelnen im Orchester; mag er die erste Violine oder den Triangel spielen: ohne Übersicht und Einfluß auf das Ganze, muß er sein Bruchstück abspielen, wie es ihm gesetzt ist, er mag es für gut oder schlecht halten. Ich will aber Musik machen, wie ich sie für gut erkenne, oder gar keine.
In einem Staate mit freier Verfassung kann ein jeder, der sich den Staatsangelegenheiten widmet, offen seine ganze Kraft an die Vertheidigung und Durchführung derjenigen Maßregeln und Systeme setzen, von deren Gerechtigkeit und Nutzen er die Überzeugung hat, und er braucht diese letztre einzig und allein als Richtschnur seiner Handlungen anzuerkennen, indem er in das öffentliche die Unabhängigkeit des Privatlebens hinübernimmt. Dort kann man in der That das Bewußtsein erwerben, für das Wohl seines Landes gethan zu haben, was in seinen Kräften stand; man mag reüssiren oder nicht, unsre Meinung mag durchdringen oder nicht, das Streben bleibt gleich verdienstlich.
Bei uns aber muß man, um an den öffentlichen Angelegenheiten Theil nehmen zu können, besoldeter und abhängiger Staatsdiener sein; man muß vollständig der Beamtenkaste angehören, ihre falschen und richtigen Ansichten theilen und jeder Individualität in Meinung und Handlung entsagen. Mißbräuche, wirkliche oder scheinbare, die mit unsern Obern, Vorgesetzten und selbst Collegen in Verbindung stehn, muß man ansehn, ohne sie offen angreifen zu dürfen, und selbst was uns untergeben ist, steht mehr unter dem Einfluß des Herkommens und feststehender Vorschriften als unter dem des Vorgesetzten. Selbst in meiner kurzen Laufbahn habe ich oft gesehn, wie die kostspielige Zeit und Arbeit schwer bezahlter Behörden auf eine Weise todtgeschlagen wurde, daß man unbedingt glauben mußte, die Geschäfte seien erfunden, um den vorhandnen Beamten zu thun zu geben, und nicht die Beamten angestellt, um nothwendige Geschäfte zu besorgen; und gegen solches und andres Unwesen kämpften ausgezeichnete Vorgesetzte mit aller Energie, aber ohne Erfolg; es liegt einmal in der Natur unsrer Verwaltung. Oft habe ich hochgestellte Beamte in Aachen und Potsdam sagen hören, diese oder jene Maßregel sei schädlich, drückend, ungerecht, und doch wagten sie nicht einmal, eine unterthänigste Vorstellung dagegen einzureichen, sondern sahn sich vielmehr in der Nothwendigkeit, sie gegen ihre Überzeugung nach allen Kräften befördern zu müssen. Wo soll da Freude an der Berufserfüllung, das Bewußtsein, Nutzen zu stiften oder auch nur seine Pflicht gegen sein Vaterland zu thun, herkommen? Conflicte der Art würden bei mir aber im Dienst ziemlich häufig sein, zumal da mein politischer Glaube dem von unserm Gouvernement anerkannten wesentlich zuwiderläuft.
Wie soll ich da die Überzeugung gewinnen, meinen Mitbürgern nützlich zu sein, wenn ich das System, nach welchem ich sie regiren helfe, für weit weniger förderlich als das entgegengesetzte, jedenfalls aber für ungerecht halte; wie soll ich selbst vor meinem Gewissen verantworten, unter die Fahne einer Regirung zu treten, deren Grundsätze zu bekämpfen, insoweit der Gehorsam gegen die bestehenden Gesetze es erlaubt, ich für eine meiner vornehmsten Pflichten gegen mein Vaterland halte. Sie werden vielleicht komisch finden, gnädigste Cousine, daß ich eine politische Überzeugung und gar ein Gewissen zu haben behaupte; indessen werden Sie zugeben müssen, daß ich jener edelsten Belohnung eines Staatsdieners, des Bewußtseins, mehr dem Wohle seiner Mitbürger als dem eignen gelebt zu haben, nur unter Voraussetzung eines Gewissens theilhaftig werden kann; Sie müssen mir daher schon gestatten, zur nähern Darstellung des Falles, daß ich aus jenem in der That würdigen Grunde in Dienst träte, ein Gewissen zu borgen, wenn Sie mir ein eignes etwa nicht zugestehn wollten. –
Für wenige berühmte Staatsmänner, namentlich in Ländern absoluter Verfassung, war übrigens wohl Vaterlandsliebe die Triebfeder, welche sie in den Dienst führte; viel häufiger Ehrgeiz, der Wunsch, zu befehlen, bewundert und berühmt zu werden. Ich muß gestehn, daß ich von dieser Leidenschaft nicht frei bin, und manche Auszeichnungen, wie die eines Soldaten im Kriege, eines Staatsmannes bei freier Verfassung, wie Peel, O’Connel[l], Mirabeau etc., eines Mitspielers bei energischen politischen Bewegungen, würden auf mich eine, jede Überlegung ausschließende Anziehungskraft üben, wie das Licht auf die Mücke; weniger reizen mich dagegen die Erfolge, welche ich auf dem breitgetretnen Wege, durch Examen, Connexionen, Actenstudium, Anciennetät und Wohlwollen meiner Vorgesetzten, zu erreichen vermag.
Dennoch giebt es Augenblicke, wo ich nicht ohne schmerzliche regrets an alle die Befriedigungen der Eitelkeit denken kann, welche mich im Dienst erwarteten; die Genugthuung, seine Brauchbarkeit und Überlegenheit durch schnelle Beförderung und andre Auszeichnungen amtlich anerkannt zu sehn, das Bewußtsein, ein Mann von Wichtigkeit und Einfluß zu sein, vor dem sich minder wichtige beugen; die selbstgefällige Betrachtung, für einen fähigen und nützlichen Menschen gehalten, bemerkt, besprochen, beneidet zu werden; die ganze wirkliche geheime Glorie, welche zuletzt mich und meine Familie umstrahlen würde, das Alles hat viel Blendendes für mich, wenn ich eine Flasche Wein getrunken habe, und ich bedarf einer nüchternen und unbefangnen Reflexion, um mir zu sagen, daß dieß Hirngespinste einer thörichten Eitelkeit sind, in eine Kategorie gehörig mit dem Stolz des dandy auf seinen Rock und des Banquiers auf sein Geld; daß es unweise und fruchtlos ist, sein Glück in der Meinung Andrer zu suchen, und daß ein vernünftiger Mensch sich selbst und dem, was er für recht und wahr erkannt, leben soll, nicht aber dem Eindruck, den er auf Andre macht, und dem Gerede, welches vor oder nach seinem Tode über ihn gehn mag. Kurz, ich bin nicht frei von Ehrgeiz, halte ihn aber für eine ebenso schlechte Leidenschaft als jede andre, und noch etwas thörichter, weil er, wenn ich mich ihm hingebe, das Opfer meiner ganzen Kraft und Unabhängigkeit fordert, ohne mir, auch bei dem glücklichsten Erfolge, eine dauernde Befriedigung und Sättigung zu gewähren. –
Noch häufiger als aus Ehrgeiz gehen wohl unsre Beamte in Dienst, um einen anständigen und sichern Broderwerb zu haben, und weil ihnen Mangel an Capital nicht erlaubt, ein andres honnettes Geschäft anzufangen. Bei meiner Lage gebe ich auch in dieser Hinsicht der Landwirthschaft den Vorzug. Sie machen mir, gn. C., gemeinschaftlich mit Bernhard, die sehr schmeichelhafte Vorhaltung, daß grade ich mit Fähigkeiten ausgerüstet sei, welche mich besondre Erfolge im Staatsdienst hoffen ließen. Wenn ich dieß zugeben würde, so schiene es mir doch noch keinen entscheidenden Grund abzugeben, um die Beamten-Carriere einzuschlagen; dieselben Fähigkeiten versprechen mir auch guten Erfolg in jedem andern Geschäft, und um eine große Landwirthschaft heut zu Tage richtig zu leiten, ist vielleicht mehr Verstand erforderlich, als um Geheimer Rath zu werden. Namentlich glaube ich, daß bei einer Wirthschaft, die so groß und überhaupt in der Lage ist, wie die Kniephofer, die volle Kraft und Industrie eines gescheuten Mannes erforderlich ist, um von jenen Gütern den Ertrag zu haben, den sie geben können, vielleicht auch nur, um sie zu erhalten, wenn noch schlechtere Zeiten kommen sollten.
Bernhard hat nicht die Absicht, den Staatsdienst ganz aufzugeben, und er paßt, wie mir scheint, besser zu demselben als ich; er ist entschiedner Anhänger der Grundsätze unsrer Regirung, findet Gefallen an seiner Amtsthätigkeit, steht sich immer mit seinen Vorgesetzten vortrefflich, weiß sich sehr gut in die Verhältnisse zu schicken, welche der Dienst mit sich bringt, und wünscht sehr lebhaft, Minister oder doch Präsident zu werden. Daß er aber, oder ich, oder wir beide zusammen, während wir im Staatsdienst abwesend sind, nebenher und par distance noch 3 große Güter persönlich bewirthschaften könnten, halte ich ohne große und gefährliche Beeinträchtigung unsres Vermögens nicht für möglich; denn schon neben den Geschäften des Landraths, wie die Pflicht sie eigentlich fordert, läßt sich die Bewirthschaftung eines bedeutenden Gutes, auch wenn man es selbst bewohnt, nicht so führen, wie das Interesse es fordert.
Wenn auch übrigens der Verwaltung unsrer Güter durch Bernhards Dasein vollständig Genüge geleistet wäre, so bin ich doch überzeugt, daß, vom rein materiellen Standpunkte aus betrachtet, ich meine Thätigkeit vorteilhafter in der Landwirthschaft als im Staatsdienst verwerthe; abgesehn davon, daß ich sogar den Besitz eines großen Vermögens für voraus erforderlich halte, um am Staatsdienst Freude zu finden, damit ich sowohl in jeder Lage mit dem Glanz, den ich für anständig halte, öffentlich auftreten kann, als auch mit Leichtigkeit im Stande bin, alle Vortheile, welche mir ein Amt gewährt, aufzugeben, sobald meine dienstlichen Pflichten mit meiner Überzeugung oder meinem Geschmack in Widerspruch treten. Wie würde es da mit mir Ärmsten aussehn, der ich von jeher einen gefährlichen Hang habe, mehr auszugeben, als ich einnehme, ein Hang, den ich nur durch die Einsamkeit mit Erfolg bekämpfe, indem ich beim Zusammensein mit meines Gleichen es schwer ertrage, in irgend einer Beziehung hinter jemand zurückzustehn. Ein Gehalt, mit dem ich bei meinen Bedürfnissen heirathen und in der Stadt einen Hausstand bilden könnte, würde ich, bei der besten zu erwartenden Carriere, im 40ten Jahre, etwa als Präsident u. dergl. haben, wenn ich trocken von Actenstaub, hypochonder, brust- und unterleibskrank vom Sitzen geworden sein werde und eine Frau zur Krankenpflege bedarf.
Für diesen mäßigen Vortheil, für den Kitzel, mich Herr Präsident nennen zu lassen, für das Bewußtsein, dem Lande selten soviel zu nützen, als ich ihm koste, dabei aber mitunter hemmend und nachteilig zu wirken, übrigens das zu erfüllen, was ich unbedachtsamer Weise zu meiner Pflicht gemacht habe, dafür bin ich fest entschlossen, meine Überzeugung, meine Unabhängigkeit, meine ganze Lebenskraft und Thätigkeit nicht herzugeben, so lange es noch Tausende und unter diesen viele ausgezeichnete Leute giebt, nach deren Geschmack jene Preise hinreichend kostbar sind, um sie den Platz, welchen ich leer lasse, mit Freuden ausfüllen zu machen…
Hier folgen einige Entschuldigungen für die Länge des Briefes und andere Dinge, eine Anzahl von Schmeicheleien, Betheuerungen und Hoffnungen, und am Schluß finden sich eine Menge guter Vorsätze, mit der bescheidnen Überzeugung ausgesprochen, daß ich immer ein sehr achtenswerthes Mitglied der menschlichen Gesellschaft bleiben werde. Das alles steht aber nicht mehr in meinem Concept, welches sehr unvollständig und ungeordnet ist, so daß ich vieles habe nur ungefähr wieder produciren können, oder auch garnicht, denn mein Brief war wenigstens noch einmal so lang als dieser. Namentlich vermisse ich, was mir besonders Bernhards halber unlieb ist, eine weitläufige Verwahrung gegen seinen Vorschlag, Beamter und Landwirth zugleich zu werden, wo man jedenfalls eins über das andere vernachlässigen, in keinem etwas vollkommnes erreichen und sich am Ende zwischen 2 Stühle setzen würde. Doch dieser Brief ist schon zu lang, und Du wirst gewiß Mühe haben, ihn ganz durchzustudiren; wenn Du nach Kniephof gehst, so sei so gut und nimm ihn an Bernhard mit oder schicke ihm denselben zu. Auch schreibst Du mir wohl bald, ob Du befiehlst, daß ich nach Stettin oder Kniephof komme, wenn Du dort bist, oder ob Du vorziehst, nach Carlsburg zu kommen, damit wir den Contract wegen der Abtretung von Külz aufsetzen; denn es kann am Ende die Landrathswahl uns über den Hals kommen und dann von Wichtigkeit sein, daß wir eine Stimme mehr haben. Wenn Bernhard erst Landrath ist, werde ich mich bemühn, Kreisdeputirter zu werden, dann hat er die Vertretung sehr bequem, wenn er will.
Als ich von Carlsburg kam, bin ich auf 24 Stunden in Putbus gewesen; ein Bekannter von der Insel nahm mich dahin mit; ich habe beim Fürsten dinirt und sehr viel Interessantes über seine Gesandschaft von ihm gehört. Er fragte, ob Du noch die Kartoffelbrennerei so stark betriebst. Er hat eine Zuckerfabrik, sehr schön und vollständig, angelegt; sie ist aber noch nicht im Gange; er forderte mich auf, sie zu sehn, und war überhaupt sehr artig. Eine sehr hübsche Frau von Stockhausen, aus Hannover, die jetzt in Berlin lebt, badete noch dort, und habe ich sie bei der Gelegenheit kennen gelernt, sowie ihren fetten hellblonden Gemal. Auf der Rückfahrt habe ich an der Seekrankheit gelitten, was mir übrigens sehr gut bekommen ist. Ich wünsche Dir ein Gleiches, d. h. ohne Seekrankheit, und bitte Dich, Mutter herzlich zu grüßen und mir bald von ihrem Ergehn Nachricht zu geben.
Dein gehorsamer Sohn
Bismarck