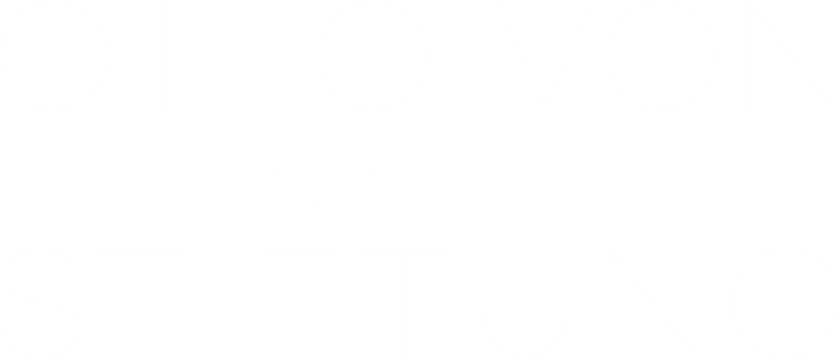Gespräch mit Kaiser Wilhelm II., Friedrichsruh
16. Dezember 1895
Helmuth von Moltke d. J. berichtet ausführlich vom Besuch Kaiser Wilhelm II. und dem Tischgespräch. Bismarck meint, dass nach seiner Erfahrung ein König seine Minister als Bollwerk gegen die politischen Anfechtungen des Tages brauche.
Fürst Bismarck erwartete die Ankunft Seiner Majestät. Im Überrock und Helm, ohne Paletot, stand die reckenhafte Gestalt des Altreichskanzlers auf dem Perron. Der Kaiser stieg rasch aus und begrüßte den Fürsten mit herzlichem Händedruck; er nötigte ihn, den Mantel umzunehmen, und nach kurzer Begrüßung des Gefolges und der mit dem Fürsten erschienenen Herren, Grafen Rantzau und Professor Schweninger, schritten wir alle dem Hause zu. In der Tür stand die Gräfin Rantzau und im Vorzimmer ihre beiden jüngsten Söhne.
Der Kaiser hatte für den Fürsten das illustrierte Werk über die deutsche Flotte von Wislicenus mitgebracht, und während er es aufschlug, um dem Fürsten die Zeichnungen zu erläutern, zogen wir uns in das Nebenzimmer zurück. Der Monarch und der Altreichskanzler blieben allein. Sie saßen sich gegenüber, jeder in einem großen Fauteuil an dem runden Tisch des kleinen Salons, die große Mappe mit den Zeichnungen der Schiffe lag zwischen ihnen. Von dem, was da etwa dreiviertel Stunden lang besprochen wurde, hörten wir nichts, wir kamen bald in lebhafte Unterhaltung mit der Gräfin Rantzau. So verging die Zeit rasch, bis um sechs Uhr gemeldet wurde, daß serviert sei.
Der Kaiser gab der Gräfin Rantzau den Arm, um sie in das anstoßende Speisezimmer zu führen, wohin wir alle folgten. Wir waren zwölf Personen an der Tafel. An ihrer Spitze saß der Kaiser, zu seiner Linken der Fürst, zu seiner Rechten die Gräfin Rantzau. Es folgten dann auf der Seite des Fürsten General von Plessen, Admiral von Senden, Kalckstein, Schweninger, auf der Seite der Gräfin Exzellenz von Lucanus, Lyncker, Dr. Leuthold, ich. Am unteren Ende des Tisches saß Graf Rantzau. Das Diner war gut, die Weine ausgezeichnet. Das Gespräch drehte sich um die alltäglichen Themata. Ab und zu redete der Kaiser einen der unten sitzenden Herren an oder trank einem derselben zu. Wie der Sekt eingeschenkt wurde, erzählte der Fürst, daß er einmal mit Friedrich Wilhelm IV. über dessen damalige Minister gesprochen habe und dem König gegenüber geäußert hätte, die Minister tränken zu wenig Sekt, sie hätten zu wenig Raketensatz in sich. Zum Nachtisch wurde ein weißer italienischer Wein geschenkt, der im Geschmack etwas an Chauteau d’Aquem erinnerte und von dem der Fürst sagte, daß er ihn jedes Jahr von Crispi geschenkt erhielte. Er fügte dann hinzu: „Er vergißt mich kein Jahr, wir sind ja beide so ein paar alte Seeräuber.“
Nachdem die Tafel aufgehoben war, versammelten wir uns wieder in dem kleinen Salon, es wurden Zigarren gereicht, und der Fürst sprach mit verschiedenen Herren des Gefolges. Der Kaiser hatte ihm bei seiner Ankunft einen Strauß von Flieder und Maiglöckchen überreicht, den der Fürst jetzt wieder in die Hand nahm, daran roch und seine Freude über die frischen Blumen äußerte. Er sprach dann über das Aussehen des Kaisers, meinte, er sehe etwas angegriffen aus, und sagte dann: „Seine Majestät wird sich wohl über seine Minister geärgert haben. Ein König könnte ja sehr viel ruhiger leben, wenn er keine Minister hätte, aber – bisweilen ist es doch ganz gut, wenn die Flut kommt und wenn dann so ein Deich da ist.“ Er wendete sich dann an Oberst von Kalckstein und fragte ihn, wo er während des Feldzuges gestanden hätte, und als er erfahren, daß Kalckstein beim ersten Garde-Landwehr-Regiment gestanden, fragte er, wie die Leute gewesen wären, ob sie willig gegangen wären und wie sie sich im Gefecht gemacht hätten. Er erinnerte sich mit Vergnügen der prächtigen Erscheinungen der Garde-Landwehr, die an der Seinebrücke Posten gestanden hätten und zu denen die kleinen Franzosen mit scheuer Verwunderung aufgeblickt hätten.
Inzwischen war die lange Meerschaumpfeife des Fürsten gebracht worden, er setzte sich in einen Lehnstuhl an den Tisch, nahm das große Bernsteinmundstück zwischen die Lippen und zündete sie an dem Streichholz an, das Professor Schweninger bereithielt. Der Kaiser, welcher jenseits des Tisches im Sofa saß, sagte zu mir, ich möchte mich neben den Fürsten setzen und ihm etwas vom Zaren erzählen. Ich setzte mich nun auf einen Stuhl dem Fürsten gegenüber und erzählte ihm, daß Seine Majestät mich vor einiger Zeit nach Petersburg geschickt hätten, um dem Zaren das Bild des Professors Knackfuß zu überreichen, und daß ich gefunden hätte, daß der Kaiser sich sehr zu seinem Vorteil entwickelt hätte. Der Fürst unterbrach mich sehr bald mit der Frage: „Was ist denn der Zar für ein Mann? Ich meine, würde er sich nicht entschließen können, vom Leder zu ziehen?“ Dabei machte er eine Handbewegung, als ob er das Schwert ziehen wollte. Ich erwiderte, daß nach meiner Ansicht der Zar hauptsächlich ein Gemütsmensch sei, worauf der Fürst sagte: „Damit wird er seine Gesellschaft nicht in Ordnung halten. Hat er denn wenigstens den Willen, Herrscher zu sein?“ Ich erzählte nun, wie gelegentlich der Unterredung, die der Zar mir gewährt, das Gespräch auf die Presse gekommen sei, und wie der Kaiser dabei geäußert habe: „Ich werde die russische Presse nicht freigeben, solange ich lebe. Eine freie Presse richtet das größte Unheil an. Die russische Presse soll nur schreiben, was ich will, und im ganzen Lande soll nur ein Wille herrschen, und das ist der meinige.“ Der Fürst sagte darauf: „Das gefällt mir, und er tut sehr wohl daran, denn wenn er auch die öffentliche Diskussion gestattet, dann wird er bald einem uferlosen Meer gegenüberstehen. Für den russischen Bauer muß der Zar, das Väterchen, ein Halbgott bleiben, ja beinahe ein Gott. Ich kenne Rußland und seine Leute, ich bin volle drei Jahre dort gewesen und habe mich umgesehen. Wenn man die sechzig Millionen Russen ihrem Zaren entfremden wollte, würden sie bald lauter Verrücktheiten machen.“
Nachdem ich gesagt, daß ich fürchte, der Zar werde nicht der Mann dazu sein, seinen Willen rücksichtslos durchzusetzen, fragte der Fürst nach der Zarin, ob sie Einfluß auf ihn habe. Ich sagte, daß die Zarin den allerbesten Eindruck auf mich gemacht hätte, daß sie entschieden Einfluß auf ihren Gemahl habe und daß zu hoffen sei, dieser werde an ihr eine feste Stütze haben. Der Fürst sagte darauf: „Ich habe auch nur Gutes von ihr gehört.“ — Hierauf kam der Fürst ohne Uebergang auf den Kaiser Napoleon III. Während die Sätze ruckweise, in der Art wie eine Maschine den Dampf abstößt, aus seinem Munde kamen, sog er in den Zwischenpausen heftig an der immer wieder ausgehenden Pfeife. Der mächtige Kopf war scharf von der Lampe beleuchtet, und die gewaltigen Augen blickten starr vor sich hin. Er wendete sich an keinen einzelnen, sondern sprach gerade hinaus. Die ganze Gesellschaft stand dicht zusammengedrängt, aller Augen hingen an seinem Munde, aller Sinne standen unter dem Bann seiner Persönlichkeit.
„Ich erinnere mich, daß, wie ich im Jahre 1856 in Paris war, da ließ mich der Kaiser Napoleon einmal rufen und legte mir die Frage vor, ob er absolut oder konstitutionell regieren solle. Ich sagte ihm: ‚Solange Eure Majestät die Garde haben, können Sie sich den Luxus dieses Experiments ja erlauben, aber wenn einmal die Flut kommt, dann ist es doch ganz gut, wenn ein Damm da ist, der zwischen Ihnen und dem Volke steht. Aber solange die Garde da ist, können Sie ja das Experiment machen.‘ – Mit den fünfzigtaufend Mann Garde konnte Paris beherrscht werden und damit Frankreich. Das waren lauter ausgesuchte Truppen, große, schöne Leute, die den Hut fürquer aufgesetzt hatten und die wußten, daß sie Paris beherrschten. Die Leute waren gut gestellt, – sie konnten bei einer Veränderung nur verlieren, – es konnte ihnen gar nicht besser gehen. Wenn sie auf der Straße gingen, wichen sie keinem Menschen aus, sie gingen immer zu zweien und wichen keinem beladenen Wagen aus.“
Der Kaiser fragte: „Wer kommandierte doch das Gardekorps damals?“ Der Fürst erwiderte: „Darauf kommt es gar nicht an. Der Kaiser konnte sich unter allen Umständen auf sie verlassen. Wer sie kommandierte, darauf kommt es gar nicht an. Ich erinnere mich, daß, wenn ich damals zum Vortrag ging, ich bisweilen einen verbotenen Weg benutzte. Wenn da einer von den kleinen Südfranzosen auf Posten stand, so sagte ich bloß: ‚Le ministre de Prusse‘ (der preußische Gesandte), – wenn aber einer von den Gardisten dastand, so sagte der mir: ‚Cela m’est tout à fait egal‘ (Das ist mir alles gleich).“ – Alles lachte, und der Fürst lachte selber herzlich mit, mit großen, offenen Augen, und nur den Mund ein wenig verziehend, gleichsam wie erstaunt darüber, daß er einen Witz gemacht habe.
Der Fürst fuhr dann fort: „Ja – also, solange er diese fünfzigtausend Mann Garde hatte, da sagte ich Napoleon, könnte er das Experiment machen. Aber es wäre doch gut, wenn er einen Wall von Ministern um sich hätte, um den ersten Stoß aufzufangen. Sonst würde das Volk ihn für jedes schlechte Wetter verantwortlich machen, c’est l’art de régner‘ (das ist die Kunst des Herrschens)! Der Kaiser war damals schon kränklich, er hatte keine rechte Energie mehr, – und dann fühlte er sich auch gedrückt durch die überwiegende Intelligenz der Kaiserin. Sie war die schönste Frau, die ich gesehen habe.“
Der Kaiser sagte, sie sei noch immer eine schöne Frau, mit ganz weißen Haaren und trotz ihres Alters von tadelloser schlanker Figur. Bismarck erwiderte: „Ja, sie war eine energische Frau, viel energischer wie der Kaiser, ich sprach zu ihr, wie man zu einem gesunden, energischen Menschen redet, aber er mag mir wohl nicht recht geglaubt haben, – er war kränklich und fühlte sich seiner Frau gegenüber inferior.“ Ich warf ein, daß er dies doch wohl mit Unrecht getan habe, worauf der Fürst erwiderte: „Wenn er unverheiratet gewesen wäre, würde er nie den Krieg gegen uns angefangen haben.“
Irgend jemand fragte, ob der Kaiser deutsch gesprochen habe, worauf der Fürst erwiderte: „Er soll es sehr gut gesprochen haben, mit mir hat er aber nie ein Wort anders als französisch gesprochen, und selbst wenn er einmal ein deutsches Wort interkalieren mußte, so sprach er es affektiert französisch aus, so zum Beispiel das Wort Kreuzzeitung.“
Inzwischen war es halbacht Uhr geworden, die Abfahrt war auf sieben Uhr festgesetzt gewesen, und Graf Rantzau meldete dem Kaiser, daß die Zeit bereits verstrichen sei.
Seine Majestät standen auf. Die Säbel wurden umgeschnallt und es wurde Abschied genommen. Irgend jemand fragte den Fürsten nach einem in Gips ausgeführten reizenden Entwurf zu einem Bismarckdenkmal für Rudolstadt, der im Nebenzimmer auf dem Tisch stand. Auf einem Sockel ist der Fürst als Student sitzend dargestellt. Die geschmeidige Sigur lehnt lässig in einem Sessel, ein Knie über das andere geschlagen; die herabgesunkene rechte Faust hält den Schläger. Jugendliche Kühnheit, gepaart mit sicherer Energie sprechen aus der Figur. Ein großer Hund strebt von unten an dem Sockel zu seinem Herrn empor.
Der Fürst nannte den Namen des Künstlers und erzählte, wie er sich dadurch hauptsächlich zur Annahme habe bewegen lassen, daß der Hund auf dem Halsband den Namen Ariel trage, – „und,“ fügte er hinzu, „so hieß mein Hund damals. In meinem Alter,“ fuhr er dann fort, „muß man die Fluten im guten wie im schlimmen über sich ergehen lassen.“ Als ihm jemand sagte, die im guten könne er sich schon gefallen lassen, sagte er: „Nein, gegen die schlimmen kann man sich wehren, aber gegen die guten ist man machtlos.“
Der Kaiser verabschiedete sich nun von der Gräfin Rantzau und ging, von dem Fürsten geleitet, zum Zuge. Nachdem er dem Alten wiederholt die Hand gedrückt, bestieg er den Zug, der sich alsbald in Bewegung setzte. Der Fürst stand hochaufgerichtet da, die Hand zum militärischen Gruß an den Helm gelegt.
Niederschrift: Helmuth von Moltke d. J.