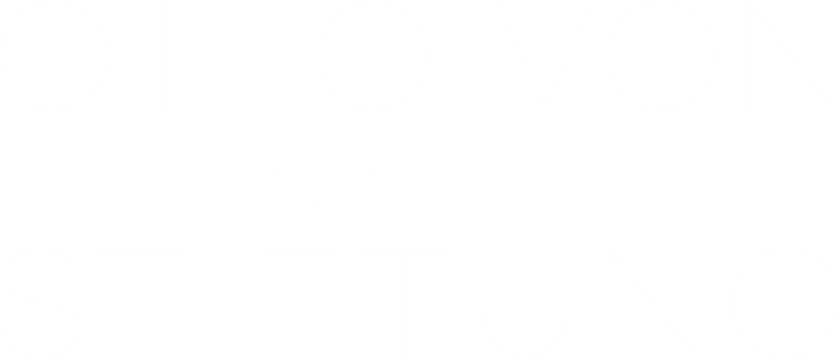Gespräch mit Eugen Wolf, Friedrichsruh
19. März 1894
Der Kaiser kenne Bismarcks Maß beim Weintrinken nicht: Wenn eine Flasche geöffnet sei, trinke er nicht „jeden Tag ein Likörgläschen davon […]. Wenn ich einmal ansetze, dann trinke ich aus.“ Zudem vertrage er anders als Wilhelm II. keinen „deutsche[n] Champagner“. Als der Kaiser ihm solchen angeboten habe, sei die ablehnende Antwort gewesen: „Majestät, der Patriotismus geht bei mir nur bis an den Magen.“
Die fürstlichen Herrschaften waren, als ich mich meldete, im Begriff, sich am Frühstückstisch niederzulassen; auch die liebenswürdige Gräfin Eickstädt war zugegen. Bismarck sieht frisch und rosig aus, kerzengerade und stramm geht er zu Tisch, allerdings stützt er sich beim Verlassen der Tafel jetzt etwas auf den Stock...
Man muß wirklich einen guten Magen haben, um bei Tisch mit dem Fürsten gleichen Schritt halten zu können. Sehr aufgeräumt und bester Laune fordert er mich in einem fort auf, zuzugreifen. Wir sprachen über den Grafen Bill, der an der Gicht leidet; dann erfreute sich der Fürst an dem Dufte der Rosen, welche ich geschickt hatte, die vor seinem Platz standen, und sagte: „Wo hatten Sie denn die herrlichen Rosen her, die man vor den Kaiser gestellt hatte, als er bei mir war?“ „Von Gebrüder Seyderhelm in Hamburg, Durchlaucht,“ worauf er sagte: „Aha, da kauft auch meine Frau.“ Damit kam die Rede auf Bismarcks Besuch in Berlin, auf den Empfang bei dem Kaiser, auf die Prinzen, auf das Essen im Schloß und auf den Erwiderungsbesuch des Kaisers in Friedrichsruh. „Es sind alles Dinge, die man der Oeffentlichkeit ruhig mitteilen kann,“ bemerkte die Fürstin, „Politik ist überhaupt nicht berührt worden.“ „Die Flasche Wein,“ warf der Fürft ein, „war zweiundsechziger Steinberger Kabinett. Der Kaiser hatte mir sagen lassen, ich möchte jeden Tag ein Likörgläschen davon trinken, aber er kennt mein Maß nicht. Wenn ich einmal ansetze, dann trinke ich aus. Ich habe die Flasche nicht mit dem Kaiser, sondern en petit comité (im kleinen Kreis) ausgetrunken. In Berlin ist mir der Weg – treppauf, treppab und im Fahrstuhl bis zur Kaiserin lang geworden; die beiden Prinzen stellten sich mir in Uniform vor; ich wurde in ein einfenstriges Zimmer geführt, hinter mir ging alsbald die Tür auf, und nun kam der Kaiser in liebenswürdigster Form auf mich zu und ernannte mich zum Regimentsinhaber. Das meiste, was die Zeitungen über meinen Aufenthalt im Schloß gebracht, war unrichtig.“
Im weiteren Verlaufe der Unterhaltung befrug mich unter anderem der Fürst über die Ernährungsverhältnisse der Neger und die Zubereitung ihrer Speisen. Die vielen Getränke, die er mir anbot, namentlich der Litauer Korn in Verbindung mit der außerordentlich anregenden, sprudelnden Tischunterhaltung wirkten mächtig auf mich ein. Die Fürstin nahm an, daß ich über Nacht bliebe; denn nach dem Frühstück sagte sie: „Sie finden in Ihrem alten Zimmer alles in Ordnung.“
Die Nachmittagspause benutzte ich zu einem Spaziergang im Sachsenwalde. . . – Um sechs Uhr sehe ich den Fürsten durch den Park schreiten, die beiden Hunde neben ihm, den Stock auf dem Rücken zwischen den Armen durchgesteckt. Zum Diner führte der Fürst die Gräfin Eickstädt; die Fürstin nahm meinen Arm. Während der Mahlzeit richtete der Fürst die Frage an mich: „Was trinken Sie am liebsten?“ Ich war schon versucht zu antworten, jede Sorte sei mir willkommen, als mir einfiel, daß der Fürst gern die Anwesenheit eines trunkfesten Gastes benutzt, um selbst einen Extratropfen daraufzusetzen. Ich antwortete also: „Guten Moselaner, Durchlaucht“, worauf er lächelnd erwiderte: „Schlechten habe ich keinen.“ Es wurde eine Flasche Bernkastler Doktor geholt und geleert. Zum Schlusse gab es ein Glas sehr alten Portwein. „Auch Champagner ist mir sehr bekömmlich“, bemerkte der Fürst, „und ein paar Glas trinke ich bei Tisch ganz gern.“ Auf meine Bemerkung, daß die deutsche Champagnerindustrie große Fortschritte mache, wie ich mich kürzlich in Schaumweinkellern am Rhein zu überzeugen Gelegenheit gehabt habe, erwiderte der Fürst: „Deutscher Champagner bekommt mir nicht. Da ist mir in Berlin folgendes passiert: Beim jetzigen Kaiser wurde einmal bei Tisch deutscher Champagner eingeschenkt, ich konnte das Etikett nicht sehen, weil die Flasche mit einer Serviette umwickelt war, aber ich schmeckte es sogleich und stellte das Glas vor mich hin, worauf der Kaiser mich frug, weshalb ich nicht trinke. Auf meine Antwort, daß ich deutschen Champagner nicht vertrage, sagte der Kaiser: „Erstens trinke ich ihn aus Sparsamkeitsrücksichten, denn ich habe eine große Familie zu ernähren, auch will ich meinen Offizieren ein gutes Beispiel geben; zweitens tue ich es aus patriotischen Gründen,“ worauf ich entgegnete: „Majestät, der Patriotismus geht bei mir nur bis an den Magen.“
Nach Tisch machte der Fürst es sich auf der Chaiselongue bequem, die Gräfin Eickstädt hielt ihm den brennenden Fidibus an die Pfeife, und wir gruppierten uns um ihn; nachdem er einige mächtige Dampfwolken geblasen hatte, zündete ich die mir von der Fürstin gebotene Havanna an. Nun wurde Kaffee und alter Kognak gereicht. Bismarcks Fraage, was mich in das Forsthaus in der Nähe von Jülich geführt habe, beantwortete ich damit, der Wald sei mein liebster Aufenthalt und in dem Forsthause wohne ein Bekannter von mir, der Hegemeister Jansen, der meinen treuen Reisebegleitern, meinen Hunden, während meines Aufenthalts in Europa Asyl gebe und bei dem ich früher schon, da er noch in der wilden Eifel stationiert war, mit Vorliebe verweilte. Darauf der Fürst: „Im Jahre 1836 war ich in Aachen als Regierungsreferendar beschäftigt. Ich kenne Düren, die hohe Senn, Montjoie, Malmedy und alle Orte jener Gegend kreuz und quer.“ Darauf wollte Bismarck etwas über die Leistungsfähigkeit des Negers von mir hören, und wie er zu behandeln sei: „Ich stelle,“ fuhr er fort, „den Neger ebenfalls nicht auf eine Stufe mit dem Weißen. Eigentlich hat Wißmann den Neger am humansten behandelt, und ich muß immer in höchster Anerkennung Wißmanns Tätigkeit gedenken, der seine Sache so gut gemacht hat.“ Anknüpfend daran ließ sich der Fürst länger über die jetzige Kolonialpolitik aus, mit der er in verschiedenen Punkten nicht einverstanden war. Auf die Frage: „Was sind Ihre jetzigen Pläne?“ erwiderte ich, nach den Gesprächen, die ich in Paris mit verschiedenen Staatsmännern geführt und in Anbetracht der politischen Vorgänge, die sich auf Madagaskar abspielten, wäre es von Interesse, diese Insel zu bereisen; auch in ethnographischer Beziehung biete dieselbe zur Zeit noch eine reiche Ausbeute. Der Fürst meinte, Madagaskar sei in Betracht seiner Lage im indischen Ozean auf dem Wege vom Kap nach Indien für die Franzosen allerdings von großer Wichtigkeit. Es würde für ihre Kolonialpolitik einen Stützpunkt hors ligne [ganz hervorragend] bieten.
Ich benutzte den Anlaß, den Fürsten zu bitten, eine Anzahl interessanter ethnographischer Gegenstände, welche ich auf meiner letzten Reise in Zentralafrika gesammelt hatte, als schwaches Zeichen meiner unbegrenzten Verehrung zum ersten April seinem Museum in Schönhausen einverleiben zu dürfen, was er huldvoll genehmigte. Als die Abendblätter kamen, las uns der Fürst einzelnes daraus vor und flocht witzige Bemerkungen ein. Beim Abschiede um neun Uhr drückte er mir die Hand, umarmte mich und gab mir einen Kuß auf die Wange, den ich, wie mir schien zu seinem Erstaunen, erwiderte. „Nun reisen Sie mit Gott, und, so Gott will, auf Wiedersehen, und wenn Sie Wißmann sehen, so sagen Sie ihm, ich hätte mich sehr gefreut, daß es ihm gut gehe, ich hätte ihm ein warmes Andenken bewahrt, ich lasse ihn vielmals grüßen.“ „Und auch ich lasse Wißmann herzlich grüßen,“ fügte die Fürstin hinzu. Damit schied ich.