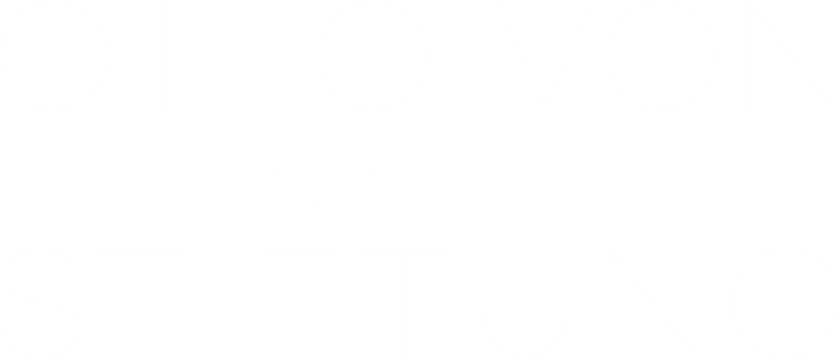Ansprache auf dem Markt in Jena
31. Juli 1892
Die Notwendigkeit der Kriege gegen Österreich und gegen Frankreich erscheint Bismarck auch in der Rückschau nachvollziehbar. Aber „weitre Kriege führen“, sei falsch. „Wir haben in ihnen nichts zu erstreben. Ich halte es für frivol oder ungeschickt, wenn wir uns in weitre Kriege hineinziehn lassen, ohne durch fremde Angriffe dazu gezwungen zu werden.“
Gegen Mittag erschien der Fürst mit seiner Familie auf dem Markte inmitten einer nach vielen Tausenden zählenden Menge von Bewohnern Jenas und Thüringens, um einem öffentlichen Feste nach Jenaer Art beizuwohnen. Oberbürgermeister Singer begrüßte ihn mit folgender Ansprache:
Durchlauchtigster Fürst, Durchlauchtigste Fürstin! Der unbeschreibliche Jubel, die immer von Neuem hochauflodernde Begeisterung der ungezählten Volksmenge, die am gestrigen Abend und in den heutigen Vormittagsstunden Eure Durchlaucht bei der Rundfahrt in den Straßen unserer Stadt begleitet haben, sprechen eine laute Sprache von der ungetheilten, aufrichtigen und herzlichen Freude unserer Mitbürger und all der zahlreihen Gäste von nah und fern und den freudigstolzen Gefühlen aller Festgenossen: in Jenas Mauern weilt der gewaltigste Mitbegründer des Deutschen Reiches, unser Bismarck.
Wenn es mithin einer besonderen Kundgebung seitens der Stadt nicht noch bedurft hätte, so mochten es sich doch die beiden städtischen Behörden nicht nehmen lassen, in ihrer Gesammtheit vor Eurer Durchlaucht zu erscheinen, um auch ihrerseits frei und öffentlich den Gefühlen der Freude und Dankbarkeit lebhaften Ausdruck zu verleihen, daß Eure Durchlaucht vor vielen andern deutschen Städten grade unser Jena mit der hohen Ehre eines längeren Aufenthaltes beglückt haben.
Mag auch unsere beinahe tausendjährige Stadt mit ihren festen Thürmen und Thoren, den ehrwürdigen Kirchen und Klöstern, dem altergrauen Rathhause, den zahlreichen mächtigen Burgen auf den Bergen in der frühesten Zeit nicht ohne Bedeutung für das Thüringer Land gewesen sein, wir wissen doch, daß seit dem Zeitalter der Reformation der politische Einfluß unserer Stadt geschwunden ist und wir uns nur freuen konnten an dem Glanze, der mit der Universität und ihren Sternen über uns aufgegangen war.
Eure Durchlaucht haben gestern Abend mit Bezug auf unsere Hochschule ausgesprochen, wir befänden uns auf classischem Boden; gestatten Sie mir hinzuzufügen, auch auf historischem. Freilich sind die weltgeschichtlichen Ereignisse, die sich an unsere Stadt knüpfen, nur ein treues Spiegelbild der Jämmerlichkeit des alten deutschen Kaiserreiches. Wenn alte Pergamente uns Kunde geben, wie Jena eine Zeit lang zur Hälfte thüringisch, zur Hälfte hessisch gewesen, so wissen Eure Durchlaucht, wie ich mit billigem Staunen gestern von Ihnen selbst gehört habe, daß Jena einst einen eigenen Herzog gehabt, der drüben schlummert in der Kirche zu St. Michael.
Im Burgkeller weilte vor drei und einem halben Jahrhundert ein deutscher Kaiser, der einen deutschen Fürsten gefangen durch unsere Stadt führte, hundert Jahre später plünderten und brandschatzten die Stadt und das Rathaus kaiserlich deutsche Truppen, während schwedisches Fußvolk die wichtige Brücke über die Saale in die Luft sprengen durfte. Und hier auf dem Marktplatze loderten vor beinahe neunzig Jahren französische Wachtfeuer zum Himmel in jener entsetzlichen Octobernacht, die der unseligen Schlacht von Jena vorausging.
Wahrlich unsere Stadt ein Bild im Kleinen von deutscher Zerrissenheit, von deutscher Ohnmacht, deutscher Schmach!
Und heute! Auf unserem Marktplatz steht der gewaltige deutsche Mann, der mit Meisterhand des Reiches Einheit, des Reiches Größe schuf! Heil uns zu dieser glücklichen Stunde! Dem Enkelsohne wird's mit stolzer Freude der Vater künden: Hier weilte Bismarck.
Heil uns, die wir den größten Sohn unseres Vaterlandes einen Tag lang beherbergen und aus seinen prophetischen Worten die zuversichtliche Hoffnung für die Zukunft unseres neugeeinten Reiches schöpfen durften: Nach Bismarck kein Jena!
All unsere Verehrung, unsere Liebe und Dankbarkeit für diesen theuren Mann wollen wir in den Ruf zusammenfassen: Allzeit und immerdar lebe Fürst Bismarck hoch!
Nach ihm nahm als Vertreter der Studentenschaft cand. med. Viett das Wort:
Durchlauchtigster Fürst!
Beseelt von dem Gefühle tiefster Dankbarkeit und erfüllt von stolzer Freude begrüßt Jenas Studentenschaft Eure Durchlaucht hier in der alten Musenstadt am Saalestrand. Uns kümmert nicht der Parteien Hader; über das Große und Erhabene kleinlich zu nörgeln, überlassen wir andern; wir, die akademische Jugend, wählen uns selbst unsere Ideale und halten sie hoch immerdar; und so stehen wir fest in immerwährender Treue, Liebe und Bewunderung zum Fürsten Bismarck. Mit unbegrenzter Verehrung schauen wir auf zu dem deutschen Reden, der unserer Väter Träume vom geeinten, großen Deutschland verwirklichte, der uns schuf das einige Vaterland, der das Bruderband schlang um Nord und Süd, um Ost und West.
Nie werden wir diese Stunde vergessen, nie vergessen, dem Altreichskanzler ins Auge geblickt zu haben. Die Hoffnungen, die Eure Durchlaucht auf Deutschlands akademische Jugend legt, sollen nicht zu Schanden werden. Hier vor Eurer Durchlaucht erneuern wir den heiligen Schwur: Dein im Leben, Dein im Sterben, ruhmgekröntes Vaterland! Dies Gelübde folgt Eurer Durchlaucht in die ferne Heimath; Gott schütze und segne auch ferner Eure Durchlaucht und Eurer Durchlaucht ganzes Haus!
Commilitonen! Ich fordere euch auf, auf Seine Durchlaucht den Fürsten Bismarck, den Mitbegründer des Deutschen Reiches, und auf ein ewiges Vivat, Crescat, Floreat das Haus Bismarck! einen donnernden Salamander zu reiben.
Fürst Bismarck erwiderte:
Meine verehrten Mitbürger vom Thüringer Lande,
ich danke Ihnen zuvörderst herzlich für den überaus freundlichen Empfang, welchen ich bei Ihnen gefunden habe. Ich kann die Gedanken, die mich bewegen, nicht besser zum Ausdruck bringen, als indem ich Ihnen meine Beziehungen zu diesem schönen Lande aus frühern Zeiten her schildere. In Thüringen habe ich als Kind zuerst Felsen, Berge und Burgen mit ihren geschichtlichen Erinnerungen kennen gelernt, welche ich in unserm nordischen Flachland, Pommern und Brandenburg, noch nicht gesehn hatte. Diese Eindrücke der Kindheit haben in meinen Empfindungen um den Begriff Thüringen einen Nimbus der Romantik gewebt, der getragen wurde namentlich durch die Erinnerungen an die Wartburg und ihre Vorzeit, in reiferer Kindheit auch durch die Erinnerung nicht nur an Luther und an die Reformation, sondern auch an die Entwicklung unsrer deutschen Sprache durch die hier zu Tage geförderte deutsche Bibelübersetzung. Es war dies der erste Anfang einer Einigung unsrer Sprache, die bis dahin in Dialekte zersplittert war. In meiner reifern Jugend lernte ich, welche Bedeutung für unsre geistige und nationale Entwicklung das Thüringer Land in Gestalt von Weimar und Jena gehabt hatte, einer Universität, an der Schiller Professor war, und welche unter der Leitung Goethes lange Zeit gestanden hat. Es ist somit erklärlich, daß für mich der Begriff „Thüringen“ auch stets mit dem Begriff „romantisch” verbunden war.
Lassen Sie mich jetzt einen Rückblick auf einige Vorgänge der Geschichte werfen. Der Name Jena hatte für mich als Sohn einer preußischen Militärfamilie einen schmerzlichen und niederdrückenden Klang. Es war das natürlich, und erst in reifern Jahren habe ich einsehn gelernt, welchen Ring in der Kette der göttlichen Vorsehung für die Entwicklung unsres deutschen Vaterlandes die Schlacht von Jena gebildet hat, welche Wirkung die Vorgänge vor und nach der Schlacht bei Jena auf die gesammten Verhältnisse unsres Vaterlandes ausgeübt haben. Ich kann mich nicht freuen bei dieser Erinnerung, mein Herz kann es nicht, wenn auch mein Verstand mir sagt, daß, wenn Jena nicht gewesen wäre, Sedan vielleiht auch nicht in unsrer Geschichte seinen glorreichen Platz gefunden hätte. Als Thatsache kann man annehmen, daß damals die Fridericianische preußische Monarchie, eine großartige, in sich einige Schöpfung, ihre Zeit ausgelebt hatte, und ich glaube nicht, daß wir, wenn sie bei Jena gesiegt hätte, eine ähnliche gedeihliche Entwicklung aufzuweisen gehabt hätten. Ich weiß das zwar nicht. Aber die Zertrümmerung des morsch gewordenen Baues — morsch, wie die Capitulationen unsrer ältesten und acht barsten Generäle aus jener Zeit erwiesen haben — war nothwendig, um freien Raum zu schaffen für den erforderlichen Neubau, und das zerschlagene Eisen der altpreußischen Monarchie wurde unter dem schweren und schmerzlichen Hammer der Fremdherrschaft zu dem Stahl geschmiedet, der 1818 diese Fremdherrschaft mit starker Elastizität zurückschleuderte. Ohne diesen Druck der Fremdherrschaft und ohne den vollständigen Verzicht auf die Vergangenheit wäre das Erwachen des deutschen Nationalgefühls im preußischen Lande, welches aus der Zeit der tiefsten Schmach der Fremdherrschaft seine ersten Ursprünge zieht, kaum möglich gewesen. Warum es nachher doch nicht zur allgemeinen Hebung gekommen ist, warum es tot discrimina rerum durchzumachen hatte, möchte ich hier nicht weiter entwickeln, um. mich nicht von Neuem dem Vorwurf der greisenhaften Geschwätzigkeit auszusetzen.
(Große Heiterkeit)
Ich will nur erwähnen, daß ich, als ich im Jahre 1832 die Universität bezog, mehr burschenschaftlich als landsmannschaftlich empfand, und daß es nur rein äußerliche Umstände waren, die mich vor der Eventualität bewahrt haben, in die spätern Gefahren der burschenschaftlichen Thätigkeit verflochten zu werden. Es war doch damals auf dem märkischen Sandboden das Gefühl der deutschen Nationalität nicht absolut fremd, daß ein irgendwie lebendiger Geist nicht in diesem Sinne empfunden und gewirkt hätte. Ich bin einigermaßen in der Entwickelung dieser Empfindungen gehindert worden durch meine Familienbeziehungen. Zu diesen kamen später die Ereignisse von 1848. Der Kampf gegen unsre eignen Landsleute in den Straßen von Berlin, gegen die Farben, die ich als Offizier mit Stolz trug, hatte einen erbitternden Rückschlag auf meine Gefühle, der noch nicht vollständig überwunden war, als wir zum Erfurter Parlament vereinigt waren. Damals habe ich Thüringen zum ersten Male auf längere Zeit wieder gesehn — wenn ich einen kurzen Aufenthalt in Jena, den der damalige Senat noch abzukürzen das Bedürfniß hatte,
(Heiterkeit)
abrechne. In Erfurt war die Frucht der deutschen Einheit noch nicht reif. So lange wir im Dualismus mit Oestreich lebten, konnte die Verschiedenheit der Individualitäten doch höchstens nur zu einer Trennung zwischen dem Norden und Süden Deutschlands führen. Das wäre das Ende vom Liede gewesen, wenn das Band des Dualismus nicht durch das Schwert gelöst worden wäre. Ich erwähne dies, um daran die Behauptung zu knüpfen, daß der Bruderkrieg mit Oestreich, den wir 1866 geführt haben, ganz unvermeidlich war. Wir mußten uns eben nach deutscher Art und Gesinnung einmal einem Gottesgericht unterwerfen und mußten uns mit Oestreich schlagen, um zu wissen, auf welche Seite sich die Entscheidung der höhern Gewalt stellen würde. Das ist geschehn und mit all der Zurückhaltung, welche Landsleute einander schuldig sind. Wir haben auf beiden Seiten seine unversöhnliche Stimmung nahbehalten. Es ist uns gelungen, mit Oestreich nachträglich in ähnliche Beziehungen zu gelangen, wie sie von den Frankfurter Verfassungsentwürfen vergebens erstrebt wurden. Wir haben sie ja heut reifer, vollständiger und wirksamer, als sie damals erstrebt wurden. Man mußte also nur dem lieben Gott Zeit lassen, seine liebe deutsche Nation durch die Wüste zu führen, um das gelobte Land zu erreichen, in dem wir uns jetzt zu befinden glauben.
(Heiterkeit)
Wir mußten diesem Kriege den mit Frankreich folgen lassen, denn wir brauchten zu unsern Einrichtungen nicht bloß die Zustimmung Oestreichs, sondern auch die des ganzen europäischen Seniorenconvents. Wir hatten aber das Bedürfniß, den französischen Krieg allein zu führen. Gegen eine Coalition von ganz Europa zu kämpfen, wie sie der siebenjährige Krieg kannte, wäre eine viel schwierigere und mißlichere Aufgabe gewesen. Es gehörte zu den göttlichen Fügungen für die deutsche Nation, auf die ich auch für die Zukunft Vertrauen habe, auch die Thatsache, daß politische Zufälle, die niemand voraussehn konnte, den engen Zusammenhang zwischen Oestreich und Rußland, der uns zur Zeit von Olmütz gegenüberstand, gesprengt hatten, und zwar in einer Weise, daß wir die Trennung der Ölmützer Verbindung für unsre nationalen Zwecke politisch benutzen konnten. Hätten uns 1866 Oestreich und Rußland noch in derselben Geschlossenheit gegenübergestanden, wie zur Zeit des Ölmützer Vertrags — Gott weiß allein, ob der Erfolg derselbe gewesen wäre, und ob wir heut auf derselben Stufe ständen. Der Bruch der Olmützer Gemeinschaft. mußte unserm Siege vorangehn, oder der selbe wäre unvollkommen geblieben, denn wir hätten im Kampfe mit Frankreich, der nothwendig war — wie er ja in jedem Jahr hundert zwei bis dreimal vorkam — unserm Gegner mit wesentlich minderer Macht gegenübergestanden, und dann wäre er vielleicht nicht so glücklich abgelaufen.
Diese Kriege waren nothwendig; nachdem sie aber geführt worden sind, halte ich es nicht für nöthig, daß wir weitre Kriege führen. Wir haben in ihnen nichts zu erstreben. Ich halte es für frivol oder ungeschickt, wenn wir uns in weitre Kriege hineinziehn lassen, ohne durch fremde Angriffe dazu gezwungen zu werden. Dann allerdings werden wir auch so stark sein, wie Deutschland in der Mitte von Europa es ist, d.h. es wird seinen Nachbarn, auch wenn sie sich verbinden, gewachsen sein. Aber nur im Defensivkrieg. Aggressive Cabinetskriege können wir nicht führen. Eine Nation, die in der Lage ist, sich zu einem Cabinetskriege zwingen zu lassen, hat nicht die richtige Verfassung. Ein Krieg, auch ein siegreicher, hat für die Nation keine wohlthuenden Folgen. Wir haben uns, nachdem wir den nothwendigen Krieg von 1870 beendigt hatten, angelegen sein lassen, zu verhindern, daß weitre Kriege geführt wurden, um vor Allem dem neuen Deutschen Reiche den Frieden zu erhalten, weil der innere Ausbau des Reiches unsre Thätigkeit voll in Anspruch nahm, ja sogar eine gewisse dictatorische Thätigkeit verlangte, die ich jedoch nicht als dauernde Institution eines großen Reiches betrachtet sehn möchte.
Wir haben unsre ganze Aufmerksamkeit in der auswärtigen Politik der Erhaltung des Friedens, in der innern der Consolidirung der Reichseinrichtungen zugewendet, in dem Sinne, daß alle Deutschen sich in den geschaffenen Verhältnissen wohlbefinden möchten, daß die Reichseinrichtungen ihnen gefallen sollten als ein Besigthum, das zu vertheidigen und zu vertreten sie Alle bereit sein würden. Inwieweit uns das gelungen ist, muß die Zeit lehren; fertig gelöst ist die Aufgabe vielleiht noch nicht. Aber sie kann nur fertig werden, wenn wir wirklich ein starkes Parlament als Brennpunkt des nationalen Einheitsgefühls haben. Dies kann aber so lange nicht der Fall sein, als dasselbe von Parteien zerrissen wird, aus denen immer neue Fractionen und Fractiönchen entstehn. Es wird dann in der Hand jedes Ministers stehn, aus den Fractionen und Fractiönchen diejenigen herauszupflücken, deren Ueberzeugung und Votum für irgend welche, ihnen gebotene Fractionsvortheile zu haben sind. Es ist unbedingt ein Unglück, wenn wir in das Fractionswettkriechen verfallen und im Reichstag einen Fractionshandel zulassen, dessen „do-ut-des“-Tendenz unsrer Verfassung nicht entspricht. Ohne einen Reichstag, der vermöge einer constanten Majorität, die er in feinem Schoße birgt, im Stande ist, die Pflicht einer Volksvertretung dadurch zu erfüllen, daß sie die Regirung kritisirt, controllirt, warnt, unter Umständen sogar führt, der im Stande ist, dasjenige Gleichgewicht zu verwirklichen, welches unsre Verfassung zwischen Regirung und Volk in dem selben wirklich hat schaffen wollen, ohne einen solchen Reichstag bin ich in Sorge für die Dauer und für die Solidität unsrer nationalen Institutionen.
(Lebhafter Beifall)
Wir können heutzutage nicht mehr einer rein dynastischen Politik leben, sondern wir müssen nationale Politik treiben, wenn wir bestehn wollen. Es ist das ein Ergebniß der politischen Entwicklung, welche in dem letzten halben Jahrhundert in Europa stattgefunden hat. Um aber nationale Politik treiben zu können, müssen wir eine nationale Volksvertretung haben, die die Bedürfnisse und Wünsche der Nation kennt und in erster Linie zur Richtschnur für ihre Abstimmungen nimmt. Wir können nicht regirt werden unter dem Einfluß und unter der Leitung einer einzelnen der bestehenden Fractionen, am allerwenigsten unter dem Einfluß des Centrums.
(Lebhafter Beifall)
Ich glaube sogar behaupten zu können, daß selbst unsre katholischen Landsleute in der Mehrzahl das Bedürfniß haben, unabhängig von der Centrumsleitung in Berlin regirt zu werden. Ich glaube, daß wir mit der ganzen katholischen Frage leichter fertig werden würden, wenn wir mit der römischen Curie durch Vermittlung eines Nuntius in Berlin zu verhandeln hätten, als wenn dessen Stelle durch die Centrumsleitung und die Beeinflussung des Centrums durch den Papst eingenommen wird. Ich sage diese Worte nur als Ausdruck des Urtheils, welches ich über die heutige Zeitung des Centrums mit mir herumtrage. Ich halte das Centrum für gefährlich nicht nur in confessionellen, sondern auch in nationalen Fragen, wie dies in den Vorgängen in den polnischen Provinzen zu Tage getreten ist. Es bröckelt uns langsam Alles wieder ab, was wir mühsam im Osten unsrer Grenzen, in Polen, germanisch aufgebaut haben. Wir hätten den ganzen Culturkampf entbehren können, wenn die polnische Frage nicht daran hing. Aber sie hing daran. Denn wir hatten damals zur Zeit der sogenannten Katholischen Abtheilung den Nuntius nicht als fremden Diplomaten in Berlin, sondern inmitten des preußischen Ministeriums in Gestalt einer Abtheilung, die ursprünglich gestiftet worden war, die Rechte des Königs der Kirche gegenüber zu vertreten, und die schließlich dahin gekommen war, thatsächlich die Rechte der Kirche und der Polen dem Könige gegenüber zu vertreten. Es ist dies ein Rückblick. Manche von Ihnen werden Geschichte studiren. Dieses Licht zurückzuwerfen, konnte ich nicht unterlassen.
Eins aber können und müssen wir vom Centrum lernen, das ist die Disciplin und die Aufopferung aller nebensächlichen und Parteizwecke für einen ihm von der Leitung bezeichneten großen Zweck. Wir sehn im Centrum die heterogensten politischen Elemente vertreten. Zu allen Zeiten waren, meiner Erinnerung nach, im Centrum reactionäre Edelleute, Absolutisten, Conservative und sogar Freisinnige bis zu den Socialdemokraten herunter vereinigt, und sie Alle stimmen geschlossen wie ein Mann für Dinge, von denen ihr Vorstand sagt, das Interesse der Kirche erfordere es. Könnten wir nun nicht, da wir doch einmal eine nationale Kirche nicht besitzen, eine ähnliche dominirende Partei schaffen, in welcher wir, ohne Rücksicht auf Fractionsvorgänge und über alle Parteiregirung hinaus, fest zusammenhalten und geschlossen für dasjenige stimmen, was die nationale Entwicklung und Sicherheit fördert, und gegen Alles, was sie untergräbt und hindert, so daß darüber kein Streit zwischen denjenigen Fractionen stattfände, die überhaupt das Deutsche Reich fördern und erhalten wollen? Es müßte ein neues Cartell geschaffen werden, in welchem die Interessen des Vaterlandes zu: oberst gestellt würden und jede Frage — analog dem Vorgehn des Centrums, das Alles aus dem römischkirchlichen Gesichtspunkt betrachtet — unter dem Gesichtspunkt der vaterländischen Interessen geprüft würde. Im Centrum werden die größten Widersprüche fallen gelassen, wenn die Autorität, die zur Leitung berufen ist, sagt, das kirchliche Interesse verlange es; dann zaudern sie keinen Augenblick, laudabiliter se subjiciunt. Warum sollten wir nicht etwas Aehnliches auf nationalem Gebiete erreichen? Warum sollten wir nicht unsern nationalen Ueberzeugungen mit derselben Energie und Ausschließlichkeit Folge leisten und Alles über den nationalen Kamm scheeren, wie die Mitglieder des Centrums von Lieber und Hite bis zum Herrn von Schorlemer hinauf,
(Heiterkeit)
welche Alle auf einen Schlag stimmen. Es ist das von den Selbstständigen unter unsern Freunden nicht in demselben vollen Maße zu erwarten, aber man muß sich immer die Regel vorhalten : „Vom Feinde soll man lernen“, und das Centrum halte ich nach wie vor für einen Gegner des Reichs, in seiner Tendenz, wenn auch nicht in allen seinen Mitgliedern, unter denen es ja auch eine Masse guter ehrlicher Deutschen gibt; aber die leitende Tendenz ist eine solche, daß ich es für ein Unglück und eine Gefahr für das Reich halte, wenn die Regirung ihre leitenden Rathgeber der Centrumsrichtung entnimmt und ihre Tendenz hauptsächlich darauf zuspitzt, dem Centrum zu gefallen. Das Centrum ist feine dauerhafte Stütze. Ich will in Frieden leben mit unsern katholischen Mitbürgern, aber ich will mich einer solchen Leitung nicht unterwerfen.
(Lebhafter Beifall)
Ich bin eingeschworen auf die weltliche Leitung eines evangelischen Kaiserthums,
(Beifall)
und diesem hänge ich treu an; dies ist das Ergebniß meiner fünfzigjährigen Erfahrung in der Politik. Wenn man mir in jedem Falle, wo ich nach meiner fünfzigjährigen Erfahrung in der Politik glaube, daß die Rathgeber meines Monarchen besser andre Wege einschlagen würden, den Vorwurf macht, ich treibe anti monarchische Politik, so möchte ich dock einmal auf unsre bestehende Verfassung aufmerksam machen, nach welcher die Verantwortlichkeit für alle Regirungsmaßnahmen nicht bei dem Monarchen, sondern bei den Ministern resp. bei dem Reichskanzler ruht. Ich möchte außerdem darauf aufmerksam machen, daß diese Auffassung — ich will nicht sagen eine altgermanische, aber doch eine uns in Fleisch und Blut liegende ist, mit welcher wir uns befreundet hatten, lange, ehe wir Verfassungen hatten. Ich will Sie nur an ein Beispiel aus den Werfen des großen Geistes erinnern, dessen Manen uns hier auf dieser Stätte umschweben. Goethe stellt uns in seinem Götz von Berlichingen einen Kaisertreuen Ritter dar, der für seinen Kaiser eine solche Anhänglichkeit und Verehrung besitzt, daß er in dem Augenblicke, wo er einen seiner Beleidiger niederschlagen will, in die Worte ausbricht: „Trügst du nicht das Ebenbild des Kaisers, das ich in dem gesudeltsten Conterfei verehre, du solltest mir den Räuber fressen oder daran erwürgen.” Dieser Ritter trug kein Bedenken, dem Kaiserlichen Hauptmann, der ihn zur Uebergabe feiner belagerten Burg aufforderte, die Ihnen allen wohlbekannte, sehr scharfe Kritik aus dem Fenster entgegen zu schleudern.
(Große langanhaltende Heiterkeit)
Es zeigt dies klar, daß Götz von Berlichingen und Goethe beide Empfindungen keineswegs zusammengeworfen und identificirt haben. Man kann ein treuer Anhänger seiner Dynastie, seines Königs und Kaisers sein, ohne von der Weisheit aller Maßregeln seiner Commissare, wie es im Götz heißt, überzeugt zu sein. ich bin Letzteres nicht und werde auch in Zukunft diese meine Ueberzeugung keineswegs zurückhalten.
(Stürmischer Beifall und begeisterte Hochrufe auf den Fürsten)
Als im weiteren Verlauf des Festes auch zu Ehren der Fürstin Bismarck ein Salamander gerieben wurde, dankte der Fürst mit folgenden Worten:
Ich sage herzlichen Dank im Namen meiner Frau, deren Stimme nicht über den Markt reicht. Nehmen Sie mich in Vertretung an. Ich bin ja dazu berechtigt.
(Große Heiterkeit)
Ich danke Ihnen herzlich in ihrem Namen.