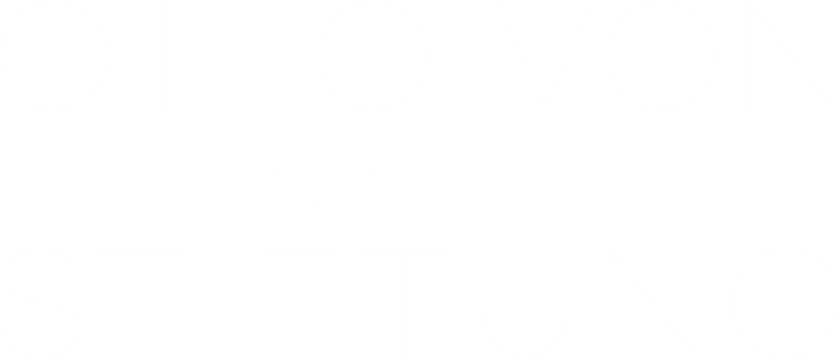Gespräch mit dem englischen Schriftsteller William Harbutt Dawson, Friedrichsruh
18. April 1892
Bismarck hätte lieber „an Stelle des Armengesetzes ein Staatsgesetz“ gehabt, „das dem Arbeiter für sein Alter statt der Armenversorgung eine Pension sichern sollte, die ihm bis zum Tod ein unabhängiges Dasein ermöglicht.“ Seiner Meinung nach hat jeder Arbeiter das Recht auf ein Existenzminimum, das ihm vom Staate eben in seiner Eigenschaft als Arbeiter gewährt werden sollte.
Ein lebhafter, fröhlicher Geist herrschte in der ganzen Tafelrunde, und die Unterhaltung war heiter wie draußen der Frühlingshimmel. Man muß nur sehen, wie die eigenen Angehörigen an den Lippen des Fürsten hängen, wenn er seinen unerschöpflichen Vorrat von Erlebnissen und Anekdoten auskramt, als ob sie auch ihnen alle neu wären. Bei Tische ist er Autokrat, aber ein liebenswürdiger, dem sich jeder gern und freudig unterordnet, um nur hören und lernen zu dürfen. Ein gelegentliches Wort aus der Tafelrunde genügt, den Fürsten zu den gewichtigsten Aussprüchen anzuregen, deren jeder einen Boswell (Biograph Samuel Johnsons) verdiente. Dem englischen Gast erzählte der Fürst mit Behagen von seinem frühen Studium unserer Literatur, wie eifrig er in seiner Jugend Byron gelesen und sich später zu Shakespeare und Moore gewandt habe.
Für den Biographen ist es interessant, daß Bismarck Carlyles Cromwell nicht gelesen hat, sondern nur seine auf Deutschland bezüglichen Werke. Dann machte der Fürst einen kleinen gutgelaunten Ausfall auf den bekannten Typus des englischen Reisenden. „Gibt es denn die englischen Reisenden von vor dreißig Jahren noch? Sie pflegten ihre Pläne mit peinlicher Gewissenhaftigkeit festzulegen: ‚Montag abend um sechs Uhr esse ich in Paris; Mittwoch mittag komme ich nach Wien, am folgenden Morgen um zehn Uhr bin ich in...‘ und so weiter. Lieber Himmel wie wäre das Leben langweilig, wenn wir unser Schicksal so voraussagen müßten!“ Dann kam die Rauchstunde; es war Frühnachmittag, und dem Fürsten wurden zwei lange zum Gebrauch fertige Pfeifen gebracht. „Ich kann keine Zigarren mehr vertragen,“ sagte er wie zur Entschuldigung, als die blauen Rauchwolken aus seinem mächtigen Pfeifenkopf aufstiegen. „Früher rauchte ich zehn, zwölf, zwanzig nacheinander, von früh bis abends. Jetzt darf ich keine mehr anrühren, sie sind mir für immer untreu geworden. Aber ich halte mich an meine Pfeife.“ Sein Kopf war ganz von dichten Rauchschwaden umhüllt. Ein Bündel Briefe werden dem Fürsten gebracht, mit dem bekannten ellenlangen Bleistift, der also wirklich vorhanden ist. .. . . . . Vor vierzehn Tagen hatte Fürst Bismarck Geburtstag gehabt und es kamen noch viele nachträgliche Gratulationen, zum Teil in Versen, deren warmer Ton ihn offenbar sehr erfreute.
„Es ist wunderbar,“ sagte er, „wie viel unbekannte Freunde ich habe. Kaum zu glauben, ich bekam achttausend schriftliche Glückwünsche zum Geburtstag und, was das merkwürdigste ist, wenigstens ein Viertel davon war in Versen! Die Kunst des Reimeschmiedens hat sich in den letzten Jahren auffallend verbreitet und findet sich in allen Bevölkerungskreisen. Da ist ein Gedicht von einem Sattlermeister — denken Sie nur, wie der dem Pegasus das Sattelzeug anlegt! .... . Und hier eines von einem Schreiner, und da von einem Schulmeister, und noch eines von einem Handwerksmann! Das da ist von einem jungen Mädchen, das sieht man an der Schrift.“ Diese letzte Epistel war zierlich auf feines Briefpapier geschrieben, und Papier, Schrift und Gefühl verrieten allesamt die jugendliche Autorin. „Am meisten hat mich gefreut, daß ein Viertel aller Glückwünsche von Frauen und Mädchen sind, das ist mir ein gutes Zeichen, denn nach meiner Erfahrung ist Frauengunst schwerer zu erlangen wie die Gunst von Männern. Eigentlich mochten mich die Frauen nie recht leiden, warum, weiß ich nicht. Vielleicht konnte ich nicht liebenswürdig genug mit ihnen plaudern. Ich werde nie die Großherzogin von Hessen vergessen; sie konnte mich nicht ausstehen und hielt mich für hochmütig. Ich spräche zu ihr, als wenn ich der Großherzog wäre. Sie teilte nämlich die Menschheit in drei Klassen ein, in Weiße, Schwarze und Großherzöge, nur daß natürlich die Großherzöge zuerst kamen.“
Dann kamen wir auf Politik zu sprechen. „Ich bin durchaus kein Anhänger des Absolutismus,“ sagte der Fürst. „In der Herrschaft eines einzelnen liegt immer eine Gefahr. Ein Herrscher kann die edelsten Absichten haben und doch unter den törichten oder gar gefährlichen Einfluß eines Günstlings oder einer Frau geraten. Solche regelwidrigen unoffiziellen Einflüsse im Rücken des Thrones sind immer gefährlich, woher sie auch stammen. Auch der klügste Herrscher kann nicht ohne Minister regieren. Ich glaube auch, daß zum monarchischen System die Stimme des Parlaments und eine bis zu einem gewissen Grad freie Presse gehören.“ Hier wies der Fürst auf das absolute aber einsichtige Regiment Friedrichs des Großen und des Großen Kurfürsten hin, das scheinbar mit seiner Theorie in Widerspruch stehe; aber man müsse bedenken, daß Menschen von so hervorragenden Gaben und Fähigkeiten besonderes geleistet haben würden, auch wenn sie nicht als Fürsten geboren wären.
Von den beiden verstorbenen Kaisern, deren einziger Kanzler er war, sprach er mit warmer, ja liebevoller Empfindung. „Der alte Kaiser war kein großer Staatsmann, aber er hatte ein reifes und gesundes Urteil. Er tat nichts, ohne einen oder mehrere seiner Ratgeber zu fragen. Und dann war er eine edle und wahrhaftige Natur; er schätzte, was die Franzosen ‚la relation sure‘ (die sichere Beziehung) nennen. Ich war ihm mit ganzer Seele ergeben.“ Und von Kaiser Friedrich: „Er war ein edler Mann mit bedeutendem Verstand, taktvoll und diskret. Er war wie ein scharfes Schwert mit kurzer Klinge.“ Was er dann über die soziale Frage sagte, ergänzte vielfach seine bekannten parlamentarischen. Aussprüche. Er war sich über die Wichtigkeit des sozialen Problems ganz klar. „Sie dürfen aber die sozialdemokratische Stimmenzahl bei einer Wahl nicht als Maßstab für die Stärke der Partei ansehen. Die Stimmen, die dem sozialistischen Kandidaten zufallen, lassen nur die Anzahl der Unzufriedenen erkennen. Jeder, der sozialdemokratisch wählt, sagt damit, ‚ich bin unzufrieden‘, und hofft durch sein Bekenntnis zu dieser Partei sein Los zu verbessern. Diese Unzufriedenheit mit der eigenen Lage ist dem Menschen ganz natürlich — den Wunsch, voranzukommen, hat Gott selbst ihm eingegeben. Und wer also mit den Sozialisten stimmt, hofft damit seine eigene Lage zu bessern. So unterstützen viele, die in keiner Weise sozialistisch denken, die sozialdemokratische Partei. – Ich fürchte die Sozialdemokratie nicht, so lange wir eine starke Regierung haben. Die Gefahr liegt im Nachgeben bei jeder noch so sinnlosen Forderung. Mit einer Regierung, die weiß, was sie will, und die Kraft hat, über das, was sie für richtig hält, nicht hinauszugehen, brauchen wir für die Zukunft nichts zu fürchten.“
Was der Fürst über das Arbeiterversicherungsgesetz sagte, wird dem Sozialhistoriker wertvoll sein. Mein Gedanke war, die arbeitenden Klassen dazu zu gewinnen, oder soll ich sagen zu bestechen, den Staat als soziale Einrichtung anzusehen, die ihretwegen besteht und für ihr Wohl sorgen möchte. Schon ehe ich das Unfallversicherungsgesetz einführte, war einiges für die Entschädigung von Verletzten getan worden; wir hatten das Haftpflichtgesetz des alten Kaisers, aber es war ungerecht und unzulänglich. Ich selbst als Privatperson konnte erkennen, wie ungeeignet es war. Es gewährte wohl gewissen Arbeiterklassen Ersatz für unter gewissen Umständen erlittenen Schaden, aber zur Feststellung ihrer Ansprüche gehörten langwierige kostspielige Prozesse, die meist damit endeten, daß der Kläger nicht zu seinem Recht kam. Aber es war doch ein Anfang, und als solcher immerhin der Mühe wert.“
Die drei Versicherungsgesetze haben die Erwartungen des Fürsten nicht erfüllt. „Sie entsprechen meinem Plane nicht ganz; sie verlangen von den Arbeitern zu viel. Das Unfallversicherungsgesetz ist ganz gewiß sehr günstig gewesen und hat viel Gutes gestiftet, aber mit den anderen Gesetzen ist man nicht weit genug gegangen. Meine Gedanken wurden von meinen Kollegen und Unterorganen falsch aufgefaßt, ich konnte wegen Krankheit und Arbeitsüberlastung damals nicht selbst in die Reichstagssitzungen kommen, und die Gesetze erhielten eine andere Form wie die ursprünglich in Aussicht genommene. Ich wollte an Stelle des Armengesetzes ein Staatsgesetz haben, das dem Arbeiter für sein Alter statt der Armenversorgung eine Pension sichern sollte, die ihm bis zum Tod ein unabhängiges Dasein ermöglicht. Meiner Meinung nach hat jeder Arbeiter das Recht auf ein Existenzminimum, und ich wünschte, daß ihm dies vom Staate eben in seiner Eigenschaft als Arbeiter gewährt werden sollte.“
„Und die Arbeitslosen?“ Die Frage drängte sich mir unwillkürlich auf. „Würde der Anspruch eines längere Zeit beschäftigungslosen Arbeiters auf diese Altersrente verfallen?“ „Nein,“ sagte der Fürst, „mein Vorschlag war, jedem Arbeiter ein unverlierbares Recht auf eine staatliche Jahresrente einzuräumen für sein Alter oder seine Arbeitsunfähigkeit. Seine Würdigkeit sollte dabei keine Rolle spielen. Die Untersuchung all seiner Taten und Untaten vom siebzehnten bis zum siebzigsten Jahre würde zu große Ansprüche an ihn stellen. Alter und Arbeitsunfähigkeit waren die einzigen Bedingungen, die ich stellen wollte. Und Sie verstehen, daß dies etwas sehr anderes ist, wie die Armenfürsorge. Diese, wie sie in England ausgeübt wird, ist eine Wohltat, die zu einem großen Teil auf privater Mitwirkung beruht. Die Altersrente aber sollte ein gesetzlicher Anspruch sein, klar und unverlierbar. Die notwendige Summe wäre gar nicht sehr hoch, hundert Mark könnten schon ausreichen, um einem alten Mann die Aufnahme bei seinen Kindern oder Angehörigen zu sichern. Aber die Versicherungsgesetze sind auch viel zu bureaukratisch.“
„Formelkram (red tape),“ warf Lothar Bucher dazwischen, einer der ältesten und getreuesten Freunde des Kanzlers, der während der Unterhaltung an meiner rechten Seite saß, und der Fürst stimmte ihm bei. Er sprach dann von den künftigen Entwicklungsmöglichkeiten der staatlichen Versicherung und trat für die Uebernahme der gesamten Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung durch den Staat ein. „Es widerspricht der Moral, aus menschlichem Mißgeschick oder Leiden Vorteile zu ziehen. Lebens-, Unfall- und Krankenversicherung dürfen nicht der privaten Spekulation überlassen werden. Sie müssen vom Staate durchgeführt werden oder wenigstens auf das Prinzip der Gegenseitigkeit begründet sein, ohne Dividenden und Nutzen für Einzelpersonen.“
Für den Kapitalisten hat Fürst Bismarck weniger Sympathie als für den Grundbesitzer, für den Fabrikanten weniger als für den Landmann. Das sprach er auch jetzt wieder aus, wie schon so oft: „Ich liebe die Aristokratie und besonders den Landadel; ich meine den Landedelmann, der auf der eigenen Scholle lebt und sie bewirtschaftet. Dieser Stand dürfte in keiner Weise geschwächt werden. In England ist die Landbevölkerung nicht so in Schutz genommen worden, wie sie es verdiente. Der Bauernstand ist das Rückgrat einer Nation.“
Dann plauderten wir noch über andere Dinge, die Unterhaltung wurde zu einer „olla potrida“ (Eintopf), aber gerade durch diese Vielseitigkeit so fesselnd und unvergeßlich. Die Aussprüche des großen Staatsmannes waren bald voll tiefer Weisheit, bald prophetisch oder witzig, und wenn Moltke der große Schweiger heißt, so ist Bismarck der Meister des Wortes. Als parlamentarischer Redner hat er einen tiefen Eindruck gemacht, noch mehr aber als genialer Plauderer in seinem eigenen gastlichen Heim.