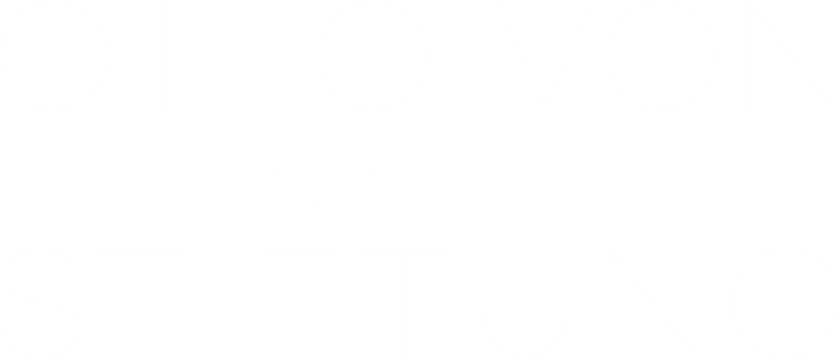Gespräche mit dem Gymnasiallehrer Horst Kohl, Friedrichsruh
26./27. November 1891
Der Inhalt seines Abschiedsgesuches mache Fehler der deutschen Politik für das Ausland sichtbar, deshalb werde er es nicht publizieren. Die Idee des Redigierens der Emser Depesche sei ihm bei einem bedrückten Abendessen mit Moltke und Roon gekommen. Als die Aussicht auf eine französische Kriegserklärung binnen Tagesfrist ihnen klar geworden sei, hätten sie mit Appetit gespeist.
Chrysander, in Abwesenheit Schweningers der medizinische Beirat Bismarcks und sein Sekretär, geleitete mich auf die Meldung des Dieners, daß der Fürst bereit sei, mich zu empfangen, nach dem zu ebener Erde gelegenen Arbeitszimmer. Beim Eintritt streckte mir der Fürst freundlich die Hand zum Gruß entgegen, und mein kurzes Dankeswort schnell unterbrechend, dankte er mir aufs herzlichste für die „Regesten“, die durch ihre bis ins einzelne genauen Angaben sein Gedächtnis bei der von ihm begonnenen Aufzeichnung seiner Erinnerungen aufs beste unterstützten. Darauf ließ er sich in seinem Sessel am Schreibtisch nieder, hieß mich Platz nehmen und ergriff die Regesten, um mir sofort einige Berichtigungen zu geben, die sich auf die ersten Seiten des Buches bezogen. Den Kopf leicht in die rechte Hand gestützt, sprach er zu mir, und überraschend war es, wie er sich der Einzelheiten aus früherer Zeit erinnerte.
„Sie berichten hier“ – das ungefähr waren seine Worte – „in der Anmerkung zu Seite drei, ich sei damals Senior der Hannovera gewesen. Das ist nicht richtig, ich war nicht Senior, bin es überhaupt nicht gewesen, ich war nur Consenior und Fuchsmajor. – Auf Seite fünf zum elften September 1844 heißt es: von Helgoland über Berlin zurück nach Schönhausen. Das ist nicht richtig. Ich habe damals Berlin nicht berührt, ich fuhr von Perleberg aus nach Klietz, um von dort aus die schöne Chaussee nach Schönhausen zu benutzen.“ Ich machte darauf aufmerksam, daß er in einem Briefe an seine Schwester aus jener Zeit von seiner Absicht spreche, über Berlin zurückzukehren; ich hätte angenommen, daß er diese Absicht dann auch wirklich ausgeführt habe. „Ja, ich entsinne mich wohl,“ entgegnete der Fürst, „daß ich die Absicht hatte; aber ich änderte meinen Reiseplan. Ein Erlebnis, das ich in Perleberg hatte, ist mir noch so lebhaft in Erinnerung, daß ich heute noch weiß, wie ich damals gereist bin. In Perleberg war damals eine sehr strenge Paßrevision. Ich hatte mich leichtsinnigerweise nicht mit einem Paß versehen und baute darauf, daß in Perleberg mein Freund von Saldern Landrat war, der mich rekognoszieren konnte, wenn man mir Schwierigkeiten machen sollte. Ich kam nach Perleberg und, nach meinem Paß befragt, berief ich mich auf meine Bekanntschaft mit Saldern. Tut mir leid, sagte der Beamte, Herr von Saldern ist auf sechs Wochen in Urlaub gegangen. Haben Sie kein amtliches Papier bei sich, das Sie legitimieren kann, so bedauere ich, Sie nicht weiter reifen lassen zu können, bis wir über Ihre Person genügende Auskunft erhalten haben. Nun blätterte ich in meiner Brieftasche hin und her, ob ich nicht ein solches Papier fände; da plötzlich greift der Beamte, der mir zugesehen hatte, hinein und zieht ein Blatt heraus, das einen amtlichen Stempel trug. Ich protestierte dagegen, das könnte mich nicht legitimieren, aber der Beamte hatte es bereits entfaltet und erklärte es für genügend. Es war ein Deckschein aus dem Gestüte. Ich habe dann mit meinen Freunden viel darüber gelacht, daß meine Stute ihren Herrn rekognoszieren mußte. Sehen Sie, an diesem Erlebnis weiß ich, wie ich damals gereist bin.“
Noch einige kleine Berichtigungen gab mir der Fürst, dann legte er das Buch zur Seite, indem er hinzufügte, er sei leider mit der Durchsicht noch nicht weit gekommen, da der Geschäfte zu viele seien, aber er werde fortfahren, systematisch, wie er begonnen, das Buch zu kontrollieren, und mir dann seine Bemerkungen zur Verfügung stellen. „Sie haben mir,“ schloß er, „mit dem Buche einen wichtigen Dienst geleistet. Als ich meine Erinnerungen niederzuschreiben begann, fehlten mir bald die amtlichen Unterlagen; eine nach Berlin gerichtete Bitte, mir Einblick in die von mir herrührenden Dokumente zu gewähren, wurde abgelehnt; dadurch geriet die Sache ins Stocken; nun gewähren mir die Regesten mit ihren genauen Angaben über die von mir ausgegangenen Depeschen, Briefe und so weiter das Material, das mir bisher fehlte, und Bucher ist schon fleißig mit der Durchsicht beschäftigt.“ Da der Fürst in seinem Briefe vom vierten November der äußeren Ausstattung des Buches hatte freundliche Anerkennung zuteil werden lassen und nur die Anwendung der lateinischen Lettern an Stelle der deutschen tadelte, da sie ihm das Lesen verlangsamten, so nahm ich Gelegenheit, mich bei ihm zu rechtfertigen. Ich erzählte ihm, daß es mir Mühe gekostet habe, für die Regesten überhaupt einen Verleger zu finden; als sich dann die Rengersche Buchhandlung bereit erklärt habe, das Risiko auf sich zu nehmen, habe sie wegen des Absatzes im Ausland die Bedingung lateinischen Druckes gestellt, und ich hätte mich fügen müssen, um mein Buch überhaupt zum Druck zu bringen. „Ja,“ fiel der Fürst ein, „der deutsche Verleger ist in einem wunderbaren Irrtum begriffen. Ein Ausländer, der Deutsch gelernt hat, kennt auch die deutschen Typen, ja, es geschieht ihm gar kein Gefallen damit, wenn er ein deutsches Buch in lateinischem Druck vor sich sieht; der Engländer und Franzose wird dann stets versucht sein, die deutschen Worte, die im Gewand seiner eigenen Sprache vor ihn treten, englisch oder französisch auszusprechen, und wird dann mit Aerger empfinden, daß er deutsche Worte vor sich hat. Sprache und Schrift stehen in Wechselwirkung zueinander. Mir geht es nicht anders. Ich wäre nicht imstande, eine englische oder französische Depesche in deutschen Buchstaben zu lesen, es würde mir in jedem Falle sehr schwer werden; und so habe ich die Beobachtung gemacht, daß ich von einem deutschen Buche, das in lateinischen Lettern gedruckt ist, in achtzig Minuten ebensoviel bewältige, als ich in sechzig Minuten lesen würde, wenn es auch deutsch gedruckt wäre. Der deutsche Verleger aber ist für solche Dinge unzugänglich.“
Der Fürst erhob sich nun und bat mich, ihm zum Frühstück zu folgen, damit er mich auch seiner Familie vorstellen könne. Im Empfangszimmer begrüßte mich die Fürstin mit schlichter Freundlichkeit; ich hatte dann die Ehre, sie zu Tisch zu führen. An der Frühstückstafel nahmen noch teil eine russische Fürstin nebst ihrer Tochter, die Baronin Merck, der Geheime Legationsrat a. D. Lothar Bucher, ein kleines altes Männchen, still und heimlich, dabei verschwiegen wie das Grab, Chrysander, der Theologie-Kandidat Lindow, der Erzieher der gräflich Ranzauschen Kinder, diese selbst, drei frische Knaben, und nach begonnener Tafel erschien auch noch die Gräfin Rantzau, die seit Monaten im elterlichen Hause lebte, fern von dem Gatten, der als Gesandter im Haag weilte. Ich hatte meinen Platz zwischen der Fürstin und der Baronin Merck, die der Fürst zur Tafel geführt hatte. Vor Beginn der Mahlzeit erhob sich der Fürst noch einmal aus seinem Sessel an der Spitze der Tafel und schritt auf den Hauslehrer Lindow zu, der an diesem Tage seinen fünfundzwanzigsten Geburtstag feierte – gleichzeitig mit dem ältesten Sohne der Gräfin Rantzau, der an diesem Tage sein zwölftes Lebensjahr vollendete – und nun die Glückwünsche der Familie empfing. Der Fürst beglückwünschte ihn herzlich zur Vollendung des ersten Vierteljahrhunderts. „Ich wünsche Ihnen, daß Sie viermal den fünfundzwanzigsten Geburtstag feiern mögen, Sie sind noch jung, da ist es Ihnen erlaubt, zu hoffen, daß Sie das Ziel erreichen. Ich habe den fünfundzwanzigsten Geburtstag schon dreimal gefeiert; ein viertes Mal ihn zu feiern, wird mir nicht beschieden sein, aber ein paar Jahre hoffe ich doch noch zu leben. Eine Geburtstagsgabe, die ich Ihnen zugedacht habe, ist bisher noch nicht eingetroffen, wird wohl aber noch im Laufe des Tages von Hamburg kommen.“ Die Fürstin überreichte dem Lehrer ihrer Enkel Gustav Freytags Bilder aus der deutschen Vergangenheit, und nach Tische brachte die Gräfin Rantzau als ihr Geschenk den großen Stielerschen Atlas.
Beim Frühstück, bei dem nach deutschem Familiengebrauch auch die Geburtstagsschokolade nicht fehlte, ging es durchaus ungezwungen her. Kieler Sprotten eröffneten den Reigen der Genüsse; der Fürst, der sie leidenschaftlich gern aß, mühte sich, die Fischlein abzuziehen, die Baronin Merck nahm ihm die Arbeit ab, aber bald wehrte er ihr in liebenswürdiger Weise. „Von der Natur,“ sagte er, „ist es weise geordnet, daß jeder derartige Genuß mit Schwierigkeiten verbunden ist. Müßte ich mich nicht plagen, um zu dem Genusse der Sprotten zu gelangen, so würde ich mehr davon essen, als meiner Gesundheit zuträglich ist; so komme ich nie über die dritte Sprotte hinaus und bleibe gesund. So ist die Mühe ein Palliativ gegen übermäßigen Genuß.“ Das Gespräch bei Tafel war mehr gesellschaftlicher Natur. Der Fürst fragte mich gelegentlich nach der Zusammensetzung des sächsischen Ministeriums, sprach im Anschluß an eine jüngst erfolgte fürstliche Vermählung von fürstlichen Konvenienzehen, bei denen leider nie die persönliche Neigung, sondern nur das dynastische Interesse befragt werde, so daß sie selten das Glück der Beteiligten begründeten, und streute auch manche humoristische Bemerkung mit ein.
Gegen zwei Uhr erhoben sich die Gäste und gingen ins Nebenzimmer; der Fürst hatte sich die Pfeife bringen lassen und blieb nun mit mir allein zurück. Das Gespräch nahm schnell eine ernste Wendung. Der Diener hatte unter anderen Zeitungen auch ein Witzblatt gebracht, auf dessen letzter Seite der Fürst als zürnender Cherub dargestellt war, der mit gezücktem Schwert vom Himmel kommt, um im Reichstag Gericht zu halten. Die Reichstagsabgeordneten, lauter winzig kleines Gewürm, stieben, von Entsetzen gepackt, auseinander, nur ein kleines Häuflein sieht frohlockend dem Erscheinen des rettenden Engels entgegen. Der Fürst reichte mir das Blatt: „Und zu solchen Leuten soll ich reden? Es ist doch eine starke Zumutung.“ Ich gab der Meinung Ausdruck, daß Millionen Deutscher ein Wort der Klärung von ihm erwarteten, denn das Gefühl der Unsicherheit habe sich fast zum Vorgefühl einer bevorstehenden Katastrophe gesteigert. Der Fürst machte daraus kein Hehl, daß auch er nicht frei sei von der Furcht eines Zusammenbruchs. Die Sorge um Deutschland lasse ihm Tag und Nacht keine Ruhe; sie konnte ihn auch veranlassen, eine Wahl für den Reichstag anzunehmen, aber er fürchte, sein Auftreten könne mehr schaden als nützen. „Würde ich reden, wie ich müßte, und Kritik üben an dem, was bisher geschehen oder unterlassen ist, so würde ich die Lage nur verschlimmern, denn ich würde nicht handeln können, und an eine Wiederübernahme der Geschäfte kann ich weder unter dem gegenwärtigen Regiment noch bei meinem hohen Alter überhaupt denken.“ In diesem Gespräch, das ich in feinen Einzelheiten wiederzugeben nicht berechtigt bin, war fast eine Stunde verstrichen. Da fiel dem Fürsten ein, daß er vor Beginn der Tafel der jüngeren der russischen Damen versprochen hatte, sich von ihr photographieren zu lassen; er erhob sich nun, ihren Wunsch zu erfüllen. Nachdem es geschehen, verabschiedete er sich von der Gesellschaft, um kurze Zeit der Ruhe zu pflegen; ich zog mich auf mein Zimmer zurück.
Gegen vier Uhr kam der Diener, um mich im Auftrage des Fürsten zu fragen, ob ich ihn auf seinem Spaziergang begleiten wolle. Natürlich war ich mit Freuden bereit und stand nach wenigen Augenblicken im Garderobenraum, den Fürsten zu erwarten. Es währte nicht lange, so kam er selbst im Ueberzieher, dessen Kragen er aufgeschlagen hatte, eine grünliche Mütze auf dem Kopfe, die Augen durch eine Brille gegen den Wind geschützt. Wir schritten in die Waldwege ein, und nach einigen Bemerkungen, die sich auf die Umgebung des Landhauses bezogen, lenkte ich das Gespräch wieder auf das politische Gebiet hinüber, indem ich den Fürsten fragte, ob er mir für den zweiten Teil der Regesten, zu dem er seine Mitarbeit mir zugesagt hatte, sein Abschiedsgesuch zur Veröffentlichung überlassen könnte. Ich erinnerte daran, daß die Hamburger Nachrichten schon einmal von der Absicht einer Veröffentlichung seines Abschiedsgesuchs gesprochen hätten, doch sei sie unterblieben. In einem Werke wissenschaftlicher Tendenz, wie die Regesten sein möchten, würde die Veröffentlichung weniger auffällig sein als in einer politischen Zeitung, und die Nachwelt habe doch auch ein Recht, zu erfahren, was die Veranlassung zu der verhängnisvollen Wendung gewesen sei. Nach kurzem Ueberlegen sagte der Fürst: „Es tut mir leid, den Wunsch nicht erfüllen zu können. Gewiß, ich habe mit der Publikation meines Abschiedsgesuches gedroht; aber ich tat es nur, um die offiziösen Blätter zur Ruhe zu bringen, die nicht aufhören, mich mit giftigen Pfeilen zu beschießen, indem sie mir für alle Mißerfolge, die die deutsche Diplomatie in den letzten anderthalb Jahren erlitten hat, die Schuld aufbürden wollen. Da habe ich gesagt: Veröffentlicht doch mein Abschiedsgesuch, oder ich kann es auch selbst tun. Aber im Ernste habe ich nimmermehr daran gedacht, es zu tun. Die Liebe zu meinem Vaterlande verbietet es mir. Mein Abschiedsgesuch ist ausführlich motiviert. Ich habe alle Fehler aufgedeckt, die begangen wurden, indem man anders handelte, als ich geraten hatte, und entwickelt, in welche Gefahren dadurch das Reich gebracht worden ist. Würde mein Abschiedsgesuch aller Welt bekannt, so würden Deutschlands Feinde erfahren, was ihnen besser unbekannt bleibt.“ Der Fürst ging nun auf die Ursachen seiner Entlassung ein und schilderte mir in ausführlicher Erzählung und nicht ohne Bitterkeit den ganzen Verlauf der Krisis, die mit den Arbeitererlassen vom Februar 1890 anhub und mit der Forderung eines einzureichenden Abschiedsgesuchs endete. Die Einzelheiten sind aus mancherlei Veröffentlichungen bekannt, ich halte mich nicht für berechtigt, die Aeußerungen des Fürsten in der Form, wie sie mir gemacht und unmittelbar nachher niedergeschrieben wurden, der Oeffentlichkeit preiszugeben.
Zum Landhaus zurückgekehrt, trat der Fürst noch vor das Außentor des Hofes, wo sich ein kleines Häuflein Menschen versammelt hatte, um den Fürsten zu sehen, begrüßte die Anwesenden durch Abnehmen der Mütze und kehrte dann zurück, um sich von den russischen Damen zu verabschieden, die gegen sechs Uhr die Rückreise antreten wollten. Gegen sieben Uhr entbot mich der Diener zum Essen. Ein neuer Gast war dazu eingetroffen, der Justizrat Philipps aus Altona, der in Rechtsgeschäften mit dem Fürsten Beratung zu pflegen hatte. Das Gespräch war auch diesmal mehr leichter, konventioneller Natur. Ich stellte an den Fürsten die Frage, ob Graf d’Hérisson in seinen Souvenirs d’un officier d’ordonnance (Erinnerungen eines Ordonanzoffiziers) sich mit Recht rühme, über Bismarck einen diplomatischen Erfolg davongetragen zu haben, indem er eine Aenderung der Kapitulationsurkunde von Paris durchsetzte, ohne dazu ermächtigt zu sein. Fürst Bismarck erklärte Hérisson für einen Schwindler. Er habe an den Verhandlungen selbst nicht teilgenommen, sondern sei nur in Begleitung Favres gekommen. Favres militärischer Assistent sei General Hautpoul gewesen, doch sei dieser schon betrunken von den Vorposten bereingekommen und habe dann während der Verhandlungen „gekotzt wie ein Schwein“. Ich erzählte, daß Hérisson sich eines Briefes von Bismarck rühme, in dem ihn dieser zu feiner patriotischen Tat — Rettung der Fahnen von Paris — beglückwünsche. Der Fürst leugnete nicht, geschrieben zu haben, doch habe er ihm nur für Uebersendung seines Buches gedankt, ihn zu beglückwünschen für etwas, was nicht sein Verdienst gewesen sei, habe er keine Veranlassung gehabt. Der Verzicht auf die Fahnen der Pariser Garnison sei schon vorher ausgesprochen worden.
Nach Tisch setzten wir uns in dem großen Salon um den runden Tisch nieder. Der Fürst, auf der Chaiselongue sitzend, zündete sich die Pfeife an. Im Gespräch mit dem Justizrat erörterte er die Rechtsgeschäfte, um derentwillen dieser gekommen war, wir andern lasen in den Zeitungen, die der Diener hereingebracht hatte.
Noch wußte ich bis dahin nicht, ob ich zur Nacht in Friedrichsruh bleiben sollte; da ich nur zum Frühstück geladen war, hatte ich kein Recht, es anzunehmen. Ich begab mich daher nach meinem Zimmer, um die Vorkehrungen zur Abreise zu treffen. Als ich wieder im Zimmer erschien und auf meinem Sessel neben der Fürstin Platz nahm, sagte sie zu mir: „Wollen Sie wirklich heute abend wieder abreisen? Wir dachten, Sie würden einige Tage bei uns bleiben? Wir haben Sie doch nicht zu der weiten Reise von Chemnitz nach Friedrichsruh veranlassen wollen, um einmal bei uns zu frühstücken.“ Mit Dank nahm ich die Einladung an und blieb zurück, als der Justizrat abreiste. Da auch Lothar Bucher sich entfernte, blieb ich mit Fürst und Fürstin allein. Der Fürst vertiefte sich in die Zeitungen und sprach nur ab und zu, wenn das Gelesene ihm Anlaß zu einer kurzen Bemerkung gab. Auch die Fürstin nahm eine Zeitung nach der andern, jede gelesene aber wanderte auf die Diele, so daß schließlich ein weiter Platz um den Tisch herum mit Zeitungen bestreut war. Nach den Zeitungen nahm der Fürst noch ein Buch zur Hand und überflog an vierzig Seiten, indem er auf jeder Seite, bald hier bald dort, eine Stelle las. Mittlerweile war es elf Uhr geworden; die Fürstin mahnte den Gemahl, daß es Zeit sei, zur Ruhe zu gehen, und Fürst und Fürstin erhoben sich.
Gegen zwölf Uhr ließ der Fürst bei mir anfragen, ob ich ihn auf seinem Spaziergang begleiten wolle. Nachdem er mich gefragt hatte, wie ich unter seinem Dache geschlafen hätte, begann er alsbald zu erzählen, wie sehr ihm die Geschäfte über den Kopf wüchsen. Er werde noch zwei Sekretäre anstellen müssen und einen juristisch gebildeten Beamten; er selbst sei zu wenig praktischer Jurist, um sich in die mancherlei Rechtsfragen zu finden, die mit der Verwaltung seiner ausgedehnten Besitzungen zusammenhingen, und seine eigenen Beamten würden durch die zahlreichen, oft arbeitsvollen Ehrenämter, zu deren Uebernahme die moderne Selbstverwaltung die Privaten verurteile, so sehr in Anspruch genommen, daß sie ihrem eigentlichen Berufskreise entzogen würden. Das gab Veranlassung zu einem sehr lehrreichen Gespräch über die Fehler der Selbstverwaltung überhaupt, die den Bureaukratismus verschlimmert und die Verwaltung verteuert habe. Unser Gespräch wurde unterbrochen, als wir die Dorfstraße kreuzten, an der sich, wie gewöhnlich um die Zeit des fürstlichen Spaziergangs, einige Menschen versammelt hatten, die den Fürsten sehen und ehrerbietig begrüßen wollten. Mit allen wechselte der Fürst einige Worte, indem er für die Beweise des Wohlwollens dankte und um die Fortdauer der freundlichen Gesinnung bat, die ihn freue und ihm wohltue. Indem wir weitergingen, gesellte sich ein Herr zu uns, der sich als Geheimer Regierungsrat F. aus Hamburg vorstellte. Er kam im Auftrage der Lübeck-Büchener Bahn, um dem Fürsten für den Versuch des Ratzeburger Kreistags, den der Fürst zugesagt hatte, einen Extrazug anzubieten. Fürst Bismarck erwiderte, er habe allerdings die Absicht, den Kreistag zu besuchen, aber der einstündige Aufenthalt in Büchen vor der Weiterfahrt nach Ratzeburg sei ihm bei seinem Alter recht unbequem. „Ich habe ja daran gedacht, mir einen Extrazug zu leisten, allein dann werden die Menschen schreien: ‚Da sieht man den Protzen und Millionär; um eine Stunde länger schlafen zu können, kauft er sich einen Extrazug‘. Und fahre ich mit dem gewöhnlichen Zuge, dann heißt es: ‚Da sieht man den Geizhals; der könnte sich doch einen Extrazug leisten, aber da wartet er lieber in Büchen eine Stunde und setzt sich, um das Geld zu sparen, den Unannehmlichkeiten aus, die das Warten auf einem kleinen Bahnhof mit sich bringt‘. Den Extrazug aber, den Sie mir anbieten, kann ich nicht annehmen, denn tue ich es, so wird man sagen: ‚Wie kommt der pensionierte Reichskanzler dazu, auf Kosten des Staates spazieren zu fahren.“ Der Geheimrat erwiderte, daß die Lübeck-Büchener Bahn Privat und nicht Staatsbahn sei, und es sich zur Ehre rechne, ihm den Extrazug zu stellen. „Das ist etwas anderes,“ sagte der Fürst, „von Privaten kann ich eine solche Aufmerksamkeit annehmen.“ Er lud den Herrn zum Frühstück ein, und wir schritten nun selbdritt dem Landhause zu. Dem Fürsten machte es Freude, uns seine Bäume zu zeigen; es war charakteristisch, wie er dabei jeden Baum mehr nach seinem Holzwerte als nach der Schönheit seines Aussehens schätzte – der Realist als Forstmann wie als Politiker.
Während des Frühstücks fragte ich den Fürsten, ob er sich eines an seine Schwester gerichteten Zettels erinnere, der, nur mit ‚Montag‘ datiert, mit den Worten beginne: „Gute Nachricht bis gestern abend neun Uhr“ und nach der Meinung der Frau von Arnim aus dem Juli 1870 stamme; die „gute Nachricht“ beziehe sich nach ihrer Ansicht auf die Meldung vom Rücktritt des Prinzen Leopold; doch kämen mir Zweifel an der Einreihung des Zettels zu Montag, den elften Juli 1870 bei, da Bismarck erst Dienstag, den zwölften Juli, nach Berlin gekommen sei, auch der sonstige Inhalt des Zettels sich nicht mit der damaligen Lage in Einklang bringen lasse. Der Fürst antwortete sofort: „Meine Schwester irrt, wenn sie meint, daß die Nachricht von der Abdankung des Erbprinzen für mich eine gute Nachricht gewesen sei; es war im Gegenteil eine recht böse. Als ich am zwölften Juli von Varzin nach Berlin kam, wurden mir am Bahnhof Depeschen überreicht, aus denen ich ersah, daß sich der König von Preußen von dem französischen Botschafter mehr hatte gefallen lassen, als mit seiner Würde vereinbar war. Da ich eine solche Demütigung nicht mit meinem Namen decken wollte, so gab ich die Reise nach Ems auf, entschlossen, mein Abschiedsgesuch einzureichen. Am dreizehnten Juli hatte ich Moltke und Roon zu mir zu Tischgeladen, um mit ihnen die Lage zu besprechen. Die beiden Generale waren über das, was in Ems geschehen war, sehr betroffen und stocherten in den Speisen, ohne recht zu essen. Da wurde mir eine Depesche gebracht aus Ems. Abeken hatte sie redigiert und eine Zuschrift des Königs darin eingeschaltet, aus der ich ersah, daß der König sich in allem nachgiebig gezeigt und nur die Forderung abgelehnt hatte, sich für die Zukunft gegen die Wiederaufnahme der Hohenzollernschen Kandidatur Frankreich gegenüber zu binden. Ich las die Depesche vor und erklärte, daß nunmehr mein Entschluß feststehe, mein Amt niederzulegen. Die Generale waren aufs äußerste betroffen. Moltke sagte: „Sie sind schöne raus; Sie gehen nach Varzin zurück und bauen dort Ihren Kohl; wir aber als Soldaten müssen aushalten und zusehen, wie sich der König die französische Ohrfeige gefallen läßt“. Als ich die Depesche noch einmal überlas, fiel mein Auge auf die beim ersten Lesen übersehene Bemerkung am Schlusse, durch welche mir anheimgestellt wurde, die neue Forderung Benedettis und ihre Zurückweisung sogleich unseren Gesandten wie der Presse mitzuteilen. Da blitzte der Gedanke in mir auf: das kann die Möglichkeit geben, die Dinge in eine andere Bahn hinüberzuleiten. Ich fragte deshalb Moltke: „Moltke, sind wir fertig?‘ ‚Ja‘ erwiderte Moltke, ‚wir sind fertig, und wir schlagen die Franzosen, denn die sind noch lange nicht fertig‘. Dieselbe Antwort gab mir Roon. Da trat ich zur Seite und strich mit dem Bleistift die Depesche zusammen und las sie in verkürzter Fassung den Generalen vor. ‚Wenn ich nun,‘ sagte ich, ‚die Depesche an die Norddeutsche Allgemeine Zeitung und die anderen Zeitungsexpeditionen in Berlin geben und in einer Viertelstunde an alle preußischen Gesandtschaften im In und Auslande telegraphieren lasse, so kommt sie noch heute nacht von zwei oder drei Seiten nach Paris, und ich müßte die Franzosen nicht kennen, wenn sie uns daraufhin nicht den Krieg erklären‘. Da sprang Moltke von seinem Stuhle in die Höhe, und der sonst so Schweigsame griff sich in die Brust und rief: „Erst klangs wie Schamade, jetzt ists Fanfare; wenn ich das noch erlebe, daß ich die Deutschen gegen die Franzosen zum Siege führe, dann mag der Teufel die alte Karkasse holen!‘ Und darauf aßen die Generale, daß es eine Lust für den Wirt war, zuzusehen.“
Geheimrat F. fragte gegen Ende des Frühstücks den Fürsten, ob er in den Reichstag zu gehen beabsichtige. Der Fürst sprach sich diesmal nicht so entschieden dagegen aus wie am Tage zuvor. Als die Fürstin hierauf etwas verstimmt das Zimmer verließ, sprach der Fürst: „Was schert mich Weib, was schert mich Kind, wenn ich meine Pflicht tun muß. Sentimentale Rücksichten dürfen nicht den Ausschlag geben, wenn es sich um die wichtigsten Fragen des staatlichen Lebens handelt.“ Der Fürst begab sich dann in den Salon, wo der Kaffee gereicht wurde. Als gegen drei Uhr sich der Geheimrat verabschiedete, bat auch ich um die Erlaubnis zur Abreise, da mich die dienstlichen Pflichten zurückriefen.