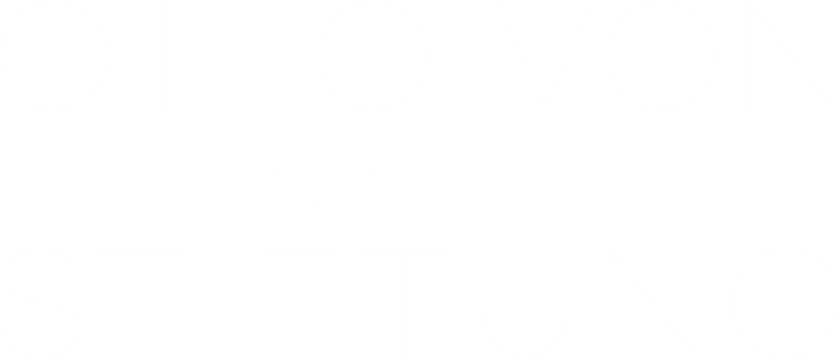Rede im Preußischen Herrenhaus, Berlin
23. März 1887
Mit dem Papst werde man die Schwierigkeiten des Kulturkampfs beenden können. Schwieriger, wenn nicht unmöglich, werde eine Aussöhnung mit dem Zentrum. Dieses habe sich von einer konfessionellen Partei zu einer regierungsfeindlichen Kraft entwickelt und scheue auch nicht vor Bündnissen mit Linksliberalen oder den Sozialisten zurück, die ihm weltanschaulich entgegenstünden.
Es war ursprünglich nicht meine Absicht und ist auch nicht meine Aufgabe, in die Specialdiskussion und in die Einzelheiten unserer Gesetzesvorlage einzugehen. Ich weiß indessen nicht, ob ich immer in der Möglichkeit sein werde, der Specialdiskussion beizuwohnen, und benutze deshalb die Gelegenheit, um wenigstens auf einige der Übergriffe in die Specialdiskussion, die der Herr Vorredner in der Generalbesprechung gemacht hat, hier zu antworten. Meine Stellung zur Sache ist ja im Wesentlichen eine andere als die des Herrn Vorredners. Ich kann weder eine konfessionelle Stellung, noch eine vom Parteistandpunkte influenzierte, noch eine juristische einnehmen. Meine Stellung ist eine rein politische, und für mich ist der Friede mit dem Papste ein Friede wie mit jeder anderen auswärtigen Macht, die im Inlande erhebliche Interessen hat. Ich stehe, wenn Sie wollen, der Sache opportunistisch gegenüber, der Herr Vorredner theoretisch. Ich habe mehr als diesen noch in nuce befindlichen Friedensschluß in meinem Leben abgeschlossen. Es ist dabei vielleicht nie oder doch selten der Fall gewesen, daß Jedermann davon befriedigt gewesen ist. Namentlich glaube ich nicht, daß es mir jemals gelungen ist, das volle Einverständniß des Herrn Vorredners zu irgend einem Vorgehen in meinem Leben zu erlangen.
(Heiterkeit)
Der Herr Vorredner ist im wesentlichen kritisch nach seiner Stellung und seinem Temperamente angelegt. Ich bin seit fünfundzwanzig Jahren unter sein Seziermesser geraten und Gegenstand seiner Kritik gewesen; aber eines vollen Beifalls hat sich noch keine Handlung in meinem Leben von seiner Seite erfreut. Ich muß also auch hier darauf gefaßt sein und finde in meiner Friedensunterhandlung in dieser Lage außerordentlich viel Analogie mit derjenigen des Jahres 1866 mit dem österreichischen Kaiserstaate. Da habe ich harte Worte hören müssen über das geringe Resultat, was wir Oesterreich gegenüber erreicht hätten, und ich habe mich beim Abschluß vollständig allein auf meine eigene Entschließung verlassen müssen. Es gab ziemlich weit verbreitete Kreise, in denen man mich den „Questenberg im Lager“ nannte, und nichts desto weniger glaube ich, wenn wir heute auf die Sache zurückblicken, werde ich mehr Anerkennung für das erwerben, was damals geschehen ist.
Der Herr Vorredner hat von dem Frieden verlangt, er solle ehrenvoll und dauerhaft sein. Nun, einen anderen als einen ehrenvollen Frieden habe ich in meinem Leben noch nicht unterzeichnet oder unterhandelt
(Lebhaftes Bravo!)
und dafür bin ich für mein Verhalten mein eigener Richter. Was aber die Dauer anlangt, so mache ich den Herrn Vorredner, der ein langes Leben – ich glaube, eben so langes wie ich – hinter sich hat, darauf aufmerksam, daß Nichts in der Welt dauernd ist, weder die Friedensschlüsse noch die Gesetze; sie kommen und gehen, sie wechseln: tempora mutantur et nos mutamur in illis (die Zeiten ändern sich und wir ändern uns in ihnen). Wie lange der Frieden oder der Ansatz zum Frieden, die Annäherung an den Frieden, die wir heute mit der römischen Kurie erstreben, wie lange sie dauert und währt, wenn sie gelingt, das kann ja Niemand voraus berechnen. Wir tun eben unsere Schuldigkeit in der Gegenwart, rebus sic stantibus (so wie die Dinge stehen), und das, was wir Günstiges und Zufriedenstellendes für das Land erlangen können, das nehmen wir an: – ob es dauert, das steht bei Gott. Also für die Dauer übernehme ich keine Verantwortlichkeit. Der Herr Vorredner hat nachher – wenn ich die Einzelheiten behandeln darf, die er berührt hat – bei der Zulassung von Orden sich namentlich auf das protestantische Gefühl berufen, was dem widerspräche, auf die Abneigung, auf den unangenehmen Eindruck, den dies mache; er hat gesagt: Die Orden sind den Protestanten verhaßt. Meine Herren, darauf kommt es nicht an; es kommt hier nicht darauf an, ob irgend etwas dem Einzelnen in seinem Innern unangenehm oder ärgerlich ist, sondern es kommt darauf an, den Frieden der Gesammtheit der Nation in ihrem Innern und des Staates herzustellen. Ich kann auch nicht denken, daß die Mehrzahl meiner Glaubensgenossen so reizbar sein sollte, daß der Anblick einer schwarzen Kutte ihnen Haß und Galle errege; es gibt vielleicht Einzelne, welche derartig empfinden, aber wir können in der Gesetzgebung auf solche Gefühle keine Rücksicht nehmen. Es kommt vielmehr darauf an, ob unsere katholischen Landsleute glauben, ohne ein gewisses Quantum von Ordensgeistlichen und prinzipielle Zulassung derselben mit uns in Frieden leben zu können oder nicht. Wenn sie das wirklich glauben, so kann ich von meinem evangelischen Standpunkt ihnen ja Unrecht geben; aber es wird mir nicht einfallen, in der Ausdehnung, wie es der Herr Vorredner gethan hat, auf eine Kritik der Frage einzugehen, ob es überhaupt vernünftig ist, daß es Mönche oder Nonnen gibt oder nicht. Das muß jeder mit seinem Gewissen abmachen, und solche Gravamina (Beschwerden) der Verdrießlichkeit von einzelnen unserer Landsleute, denen schwer etwas recht zu machen ist, abzustellen, dazu ist die Gesetzgebung und die Politik überhaupt nicht da. Für mich ist entscheidend, daß von katholischer Seite man daran hängt.
Ich habe auch bei Friedensschlüssen mit fremden Mächten meinerseits mir nicht die Frage vorzulegen gehabt, warum mag Österreich, Frankreich, Dänemark diese oder jene Forderung mit der Bestimmtheit stellen; ich habe mich darauf einlassen müssen, daß es eben gefordert wurde. Welches Bedürfniß an Orden wir haben, das ist eine Sache, die schließlich von dem Urteil unserer katholischen Landsleute abhängt.
Der Herr Vorredner hat auch in Bezug auf andere Punkte die Frage aufgeworfen. Warum sollen wir denn nicht Punkte aufgeben, die meines Erachtens für uns ganz ohne Wichtigkeit sind? Ich glaube, es bezog sich auf die Strafgewalt der Geistlichen. Ob ein katholischer Geistlicher strenger oder gelinder behandelt wird, ist für den Staat vollkommen gleichgültig, der Geistliche weiß, was ihm bevorsteht, und muß sich, wenn es zu hart ist, selbst anklagen, der Staat kann nicht einmal in dem viel näher zu Tage liegenden Verhältniß zwischen Lehrern und Kindern eingreifen, da wird auch oft das Züchtigungsrecht überschritten, dagegen läßt sich nicht schützen; – wer die Disziplin der katholischen Geistlichen nicht erträglich findet, der soll nicht Geistlicher werden, ebenso wer die militärische Disziplin nicht ertragen kann, soll nicht Soldat werden, wo er es vermeiden kann; für die Zeit, wo er eben Soldat sein muß, kann er es nicht.
Der Herr Vorredner hat Ähnliches in Bezug auf die Priestererziehung bemängelt, und er legt dieser Seite der Sache einen Wert bei, den ich für übertrieben halten muß. Daß die Priester gut und richtig erzogen werden, daran wird dem Papste und den Bischöfen sehr viel liegen, aber den Gedanken, der der Maigesetzgebung zum Theil zu Grunde lag, durch die Priestererziehung nun auf das künftige Verhalten der Priester zu den Laien und ihre Toleranz gegen Andersgläubige im Wege der Erziehung und Vorbildung einwirken zu wollen, halte ich für verfehlt; es hängt von der Erziehung gar nicht so ab, wie von den späteren Erlebnissen, von den Einwirkungen der Vorgesetzten, ich möchte sagen, von der ganzen Witterung, die in Bezug auf diese Dinge in der Zeit herrscht, in der einer lebt, und wir können in der Erziehung eines Priesters, mag sie nun sehr freisinnig und weitgebildet sein, gar keine Garantie suchen, daß der Geistliche später nicht staatsfeindlich auftritt und gerade die besseren Waffen, mit denen er durch die staatliche Erziehung ausgebildet ist, gegen den Staat verwendet. Meiner Überzeugung nach – ich kann nach meinen Erfahrungen aus den jüngsten Tagen, wo ich etwas in die Statistik und Genesis der Einzelnen unserer Gegner hineingegangen bin, nicht verschweigen, daß unsere schärfsten und bittersten Gegner Zöglinge der Universitäten und nicht der Seminarien gewesen sind. Ich will einzelne Universitäten nicht nennen; das Material hat für mich genügt, um den Beweis zu liefern, daß die Nötigung zum Universitätsstudium mit Abschneidung der Seminarien kein Mittel ist gegen die Schäden, die wir bekämpfen wollen. Ein Seminar bei einem friedliebenden, wohlwollenden, deutsch gesinnten Bischof ist mir lieber als das Studium auf der Universität, wo niemand eigentlich für die Erziehung verantwortlich ist, bei allen Einflüssen, die sich unkontrolliert an den Studenten heranmachen. Also auf die Seminarfrage lege ich so sehr viel Wert nicht, und ebenso bin ich nicht gleicher Meinung mit vielen meiner Freunde über den Wert der Garantie, welche in der Anzeigepflicht liegt. Ich schöpfe auch da mein Urteil mehr aus dem Leben wie aus der Theorie. Wir haben erlebt, daß gerade Geistliche, die wir seit längerer Zeit genau kannten, die zu keinerlei Beschwerden Anlaß gegeben hatten, die wir selbst empfohlen haben, von dem Augen-blick an, wo sie im Sattel saßen, die schärfsten Gegner geworden sind. Ich erinnere nur an Jemand, der jetzt nicht mehr lebt und dem deshalb die Kritik nichts schadet, an den verstorbenen Fürstbischof von Breslau,- der hat fünfzehn Jahre amtiert unter den Augen aller Behörden, und es wird wohl selten vorkommen, daß man einen Priester vor der Anstellung so genau kennt, wie man diesen kannte, und die Regierung hat nachher über wenig Prälaten in Preußen stets so viel Klagen gehabt, wie gerade über diesen Herrn, unter dessen Leitung in Schlesien sich die Dinge in einer Richtung entwickelt haben, die früher der Bevölkerung völlig fremd und unnatürlich gewesen wäre.
(Sehr gut!)
Also das zeigt nur, daß man den Wert der Anzeigepflicht leicht überschätzen kann. Man steckt in dem angestellten Priester doch nicht drin, und mit dem Papst und der Kirche eine Art von Wettlauf in der Beeinflussung der angestellten Priester anzustellen, halte ich eben auch für ein verfehltes Unternehmen. Da werden wir eine gleich starke Einwirkung niemals erreichen können. Sobald der Geistliche angestellter Priester ist, wird er seinen Oberen gehorchen oder er wird seine Stellung ruinieren, und ebenso wie beispielsweise ein Officier, der mit einem Kriege, den man führt, nicht einverstanden ist, wird er ganz ruhig seine Schuldigkeit in der Stellung tun, wie sie ihm von oben gegeben wird, und es wird uns nichts helfen, wenn wir einen Geistlichen in eine Stellung bringen, der uns wohlgesinnt ist; er wird es für die Dauer nicht bleiben, wenn seine Vorgesetzten und die ganze Temperatur, die ihn umgibt, in entgegengesetzter Richtung auf ihn einwirkt. Ich habe von Anfang an, seit ich den Fragen näher getreten bin – ich will gleich nachher darauf kommen, wann das der Fall gewesen ist – nicht die Überzeugung gewinnen können, daß die Anzeigepflicht dem Staate die Bürgschaft gewährt, die man davon erwartet, und daß es deshalb der Mühe wert sei, mit Schärfe und Hartnäckigkeit für ihre größere oder geringere Ausdehnung zu kämpfen. Wenn ich meine Privatmeinung sagte, also wenn ich lediglich als Mitglied des Herrenhauses spräche, dann würde ich jagen: Ich frage nach der ganzen Anzeigepflicht nicht, aber ich kann meiner Privatmeinung nicht Geltung verschaffen, ich spreche im Namen einer Regierung, die ihre Entschlüsse gemeinsam faßt, und im Namen derjenigen Freunde und befreundeten Elemente, von denen die Regierung ihre Unterstützung bezieht und auch in Zukunft beziehen muß; ich habe daher kein Recht, meiner Privatmeinung in dieser Beziehung Ausdruck zu geben – sie mag ja auch irrig sein –, und da sage ich mir: Was Deines Amtes nicht ist, davon laß Deinen Fürwitz. – Zur Beantwortung der Kritiken, die von der Idee ausgehen, als ob wir staatliche und Hoheitsrechte überhaupt aufgeben, wie auch der Herr Vorredner getan hat , erwähne ich nur, daß Jemand, wie ich, dessen Patriotismus und dessen Gefühl für die Würde des Königs und Staats nicht angezweifelt werden kann, nicht umhin kann, in dieser Frage noch weiter zu gehen, weil sie nicht so nützlich und wertvoll erscheint, um den Frieden deshalb noch weiter zu gefährden. Die Behauptung, als ob der Staat bisherige Hoheitsrechte aufgebe und dadurch an seiner Würde verlöre, hat der Herr Vorredner im Anfang feiner Rede, ich habe es mir wenigstens zuerst notiert, ausgesprochen; ich muß ihn aber doch daran erinnern, daß wir auch bis zum Jahre 1871 bis kurz vor der Maigesetzgebung unter Umständen gelebt hatten, wo alle diese Hoheitsrechte, wie er es nennt, die wir jetzt aufgeben, noch gar nicht bestanden und viele andere auch nicht, die wir setzt behalten, und wo wir von der Verfassung selbst in der Staatshoheit in einer Weise eingeschränkt waren, die heut zu Tage nicht mehr besteht.
Nichtsdestoweniger glaube ich, daß niemand das Recht hat zu bezweifeln, daß der preußische Staat seine Hoheitsrechte und seine Würde auch vor der Maigesetzgebung vollständig gewahrt hat. Es haben damals viele Einrichtungen bestanden, die der römischen Kirche noch bedeutendere Rechte gaben und die in der Tat Beschränkungen der Hoheitsrechte des Königs waren. Ich brauche nur an die katholische Abtheilung zu erinnern und an manches andere, was in der Verfassung stand, und wir haben uns doch nicht für schlechter gehalten als heut zu Tage, obschon wir mit solchen Hypotheken, will ich mal sagen, belastet waren. Ein jedes Gesetz ist ja ein Verzicht des Staates auf ein Hoheitsrecht in dem konstitutionellen Staat; es bindet ja den Staat in einer gewissen Weise, – ob dem Landtage gegenüber oder in anderer Weise, das ist ja eine Frage für sich.
Bei der Erwähnung der Orden habe ich noch übersehen, daß der Herr Vorredner einen Grund seines Widerspruches aus der Abhängigkeit der Orden von ausländischen Oberen motiviert hat. Nun, - das kann ja unter Umständen unbequem sein, aber meiner Überzeugung nach ist die Abhängigkeit unserer Reichsgenossen von inländischen Oberen viel beklagenswerter,
(Bravo! Heiterkeit.)
– und es gibt eine Menge von Fraktionen und politischen Richtungen, die ich gerne dafür hingeben würde, um dafür einen ausländischen Orden einzutauschen,
(Große Heiterkeit. Bravo !)
und bei denen das System des unbedingten Kadavergehorsams und des sacrificium intellectus (Opfer des Intellekts) viel ausgebildeter ist wie bei den Klosterorden. Die propagandistische Tendenz, die der Herr Vorredner von den religiösen Orden befürchtet, wird von den inländischen Orden mit parlamentarischen Oberen, von den parlamentarischen Fraktionsorden mit sehr viel größeren, mit anderen Mitteln betrieben, und
(Heiterkeit.)
allein aus dem Grunde müßte man viel schärfer in das Vereinsrecht eingreifen, und namentlich bei den Fraktionen – mit inländischen oder ausländischen Oberen, – sehr viele von den Fraktionen haben auch ausländische Obere!
(Große Heiterkeit.)
Aber dies berührt alles nicht meine politische Stellung zu der Gesammtvorlage, und ich glaube, ich kann darüber nicht besser Klarheit verbreiten, und auch über den Weg, auf dem wir dazu gekommen sind, als wenn ich mit der Verlesung einer Äußerung beginne, die ich in einer Zeit getan habe, wo die Wogen des Kulturkampfes gerade am höchsten gingen, im Frühjahr 1875, und aus der unwiderleglich hervorgeht, daß wir doch auch damals die ganze Gesetzgebung, die der Grund des Kampfes und des Streites war, lediglich als eine Kampfgesetzgebung und als eine Waffe, um den Frieden zu erkämpfen, betrachteten. Wir haben damals unsere Arsenale gefüllt, aber doch nicht dauernde Einrichtungen damit erstrebt, die ewig dauern sollten. Wenn man glaubt, am Vorabend eines Krieges zu stehen, sich Vorräte von Melinit und anderen explosiven Körpern anlegt, wird man das doch nicht dauernd als Mobiliar in der eigenen Wohnung betrachten wollen.
(Heiterkeit.)
Und so halte ich einen großen Teil der Gesetze, die wir damals gegeben haben, mit Ausnahme derjenigen, die einige Fehler der Verfassung wieder gut machten, für solche, die man in Streit und Kampf machte, aber daß ich nicht der Ansicht war, daß dies eine dauernde Institution sein werde, das geht vollständig klar aus einer Äußerung hervor, die ich am 10. April 1875 getan habe. Sie bezog sich auf eine ältere Friedensverhandlung, die schon im Jahre 1871 stattfand, also zu einer Zeit, wo der Staat noch gar nicht eigentlich an Kämpfe dachte, wir aber doch schon die Gefahren vorausgesehen hatten, die aus der Bildung einer konfessionellen Fraktion auf politischem Gebiete für unseren kirchlichen Frieden sich entwickeln könnten, und eine Vorstellung an den damaligen Kardinal Antonelli gemacht hatten. Auf unsere Vorstellung wurde uns geantwortet, daß der Kardinal das Vorgehen des Zentrums mißbillige, — daß der Papst selbst das Austreten der katholischen Partei im Reichstage als inopportun und unpraktisch bezeichnet und beklagt habe. In einem Berichte aus Rom vom 21. April 1871 wird gemeldet: „Der Cardinal Antonelli erklärte mir, daß er die Haltung der katholischen, der sogenannten Zentrumsfraktion im Reichstage als taktlos und unzeitgemäß mißbillige und beklage”.
Diese Stimmung des Kardinals hielt nur so lange aus, bis ein süddeutscher Standesherr, Fürst Löwenstein, im Auftrage des Zentrums nach Rom reiste und wir von dort aus eine andere, weniger ungünstige Stimme in Bezug auf das Zentrum zu vernehmen hatten. Darauf ging der Kampf seinen Weg, und im Jahre 1875 äußerte ich Folgendes:
Daß ich damals mit dem Papst selbst in Verbindung gestanden hätte, ist ja nach der Form der diplomatischen Geschäfte gar nicht annehmbar, meine Verbindungen beschränkten sich auf den, wie gesagt, gescheiten, jetzt aber leider einflußlosen Kardinal Antonelli. Indessen bewahre ich die Hoffnung, daß der päpstliche Einfluß auf das Centrum sich erhalten werde.
Diese Hoffnung hat sich nicht in dem Maße bestätigt, wie ich sie damals hegte.
(Heiterkeit.)
Denn wie uns die Geschichte kriegerische Päpste und friedliche, fechtende und geistliche zeigt, so hoffe ich, wird doch auch wieder einmal demnächst die Reihe an einen friedliebenden Papst kommen, der nicht lediglich das Produkt der Wahl des italienischen Klerus zur Weltherrschaft erheben will, sondern der bereit ist, auch andere Leute leben zu lassen nach ihrer Art, und mit dem sich Frieden schließen lassen wird; – darauf ist meine Hoffnung gerichtet, und dann hoffe ich, wiederum einen Antonelli zu finden, der einsichtsvoll genug ist, um dem Frieden mit der weltlichen Macht entgegen zu kommen.
Dies verlese ich nur, um die logische Konsequenz der späteren Haltung der Regierung daran zu knüpfen. Der Fall, auf welchen hin ich diese Hoffnung aussprach, trat ein im Jahre 1878. Als der jetzt regierende Papst sein Amt antrat, ließ sich sehr bald merken, daß der Herr die Neigung hatte, den Streit aus der Welt zu schaffen und als eine der Aufgaben seiner hohen Mission die Herstellung des äußeren und inneren Friedens der Welt auffaßte. Ich habe infolgedessen schon damals ein Programm vertreten in unseren Vorbereitungen zur Gesetzgebung, welches ziemlich genau übereinstimmt mit der Gesamtheit dessen, was seitdem an Konzessionen vorgelegt wurde, mit Einschluß dessen, was wir heute beantragen. Aber es ist ein richtiger Beweis dafür, wie irrtümlich die Erzählungen von einem allmächtigen Minister find, wenn ich sage, daß ich fast zehn Jahre gebraucht habe, um dieses Programm allmählich der Ausführung näher zu bringen, und notwendig so lange brauchen mußte, wenn ich Krisen und Gefahren für die ganze Stellung der Regierung vermeiden wollte. Wie ich schon vorher sagte, wir haben nötig, nicht nur unter uns uns zu verständigen, sondern auch in Fühlung zu bleiben mit denjenigen Elementen im Lande, auf deren Unterstützung wir zählen und rechnen, und danach unser Verhalten zu bemessen. Kurz, ich habe seitdem dasselbe Ziel verfolgt, für das ich heute hier eintrete, eines Friedensschlusses mit Rom, mit dem Papste. Ob das nun ein definitiver und ein dauernder sein wird, ja, dafür bin ich nicht verantwortlich. Aber selbst ein provisorischer, wenn er wieder angefochten würde, ist mir lieber als gar keiner! Und sollten die Herren finden, daß die Zustände, die nach diesem Frieden eintreten, ganz unerträglich sind und daß es sich unter denselben nicht leben läßt, so steht gar nichts im Wege, daß dieselben Kräfte, die früher die Maigesetze zu Stande gebracht haben, neue Maigesetze machen, ganz dieselben, wenn Sie wollen. Wenn Sie glauben, daß dies dem Frieden dienlicher und der Würde entsprechender ist, so lassen sich Gesetze ebenso aufheben, wie neue machen. Sie sind nicht für die Ewigkeit geschaffen.
Ich habe nun den Versuch, zum Frieden zu gelangen, schwieriger gefunden, als ich mir vorstellen konnte, weil ich in der Zwischenzeit mehr anderen auswärtigen Geschäften als den inneren Dingen gelebt habe. Ich fand, daß die gegenseitige Verbitterung zu einem hohen Grade gestiegen war, beeinflußt durch die parlamentarischen Kämpfe, durch die sich kreuzenden Fraktionsinteressen, durch Bündnisse und Gegenbündnisse, durch den Kampfeszorn, in den der Deutsche sich mit Vorliebe versetzt, namentlich, wenn es sich um theoretische, um Glaubensstreitigkeiten handelt.
(Heiterkeit.)
Die Verbitterung war auf beiden Seiten sehr lebhaft vorhanden und sehr erklärlich durch die Hitze und die Dauer des Gefechtes, das geführt war, durch die Vergiftung der eigentlichen, ursprünglichen Streitgegenstände, durch das Hineinziehen sehr vieler anderer, hauptsächlich aber dadurch, daß die Zentrumspartei aufhörte, eine rein konfessionelle zu sein, und es nützlicher fand, eine antistaatliche Partei zu sein, den Staat überhaupt zu bekämpfen unter Zuhilfenahme aller Elemente, die dazu bereit waren. Ich rechne dazu zunächst die Welfen, die den Zustand negierten, der im Jahre 1866 geschaffen wurde; ihnen fiel sogar ein wesentlicher Antheil an der Führung dieser Fraktion zu; dann die polnische und französische Partei, die allmählich bei uns entstanden. Eine zufällige Unterstützung für Regierungsgegner wurde durch die sozialistischen Stimmen gegeben und schließlich auch durch die Fortschrittspartei, die sich dem Zentrum anschloß, weil ihr Haß gegen die Regierung größer war als ihre Abneigung gegen den Papst und die katholische Kirche. Auf diese Weise entstand eine regierungsfeindliche Majorität, von der die Regierung mit allen Waffen, die jeder einzelnen der sie bildenden Parteien zu Gebote standen, bekämpft wurde, und in Folge dessen eine sehr wesentliche Verbitterung.
Bei der ersten Entstehung des Centrums war der Streit noch nicht so schwer beizulegen. Ich möchte sagen, es schien mir damals mehr die Absicht vorzuliegen, das Deutsche Reich und dessen Verfassung zu benutzen, um der katholischen Kirche in den außerpreußischen Ländern eine bessere Stellung zu verschaffen. Ich erinnere mich, daß beispielsweise Bischof Ketteler mit mir darüber verhandelte, ob man nicht der Katholischen Kirche günstige Bestimmungen der Preußischen Verfassung in die Reichsverfassung aufnehmen könnte. Andere Verhandlungen gingen auf territoriale Fragen der päpstlichen Landeshoheit hinaus. Kurz, man war weit entfernt, die Reichsregierung als ein feindliches Element zu behandeln. Man hoffte auf unsere Unterstützung. Wir konnten diese Unterstützung nach mehreren Richtungen hin nicht gewähren, und allmählich gewannen die Elemente Oberhand, die nicht nur der Religion wegen und zur Erhöhung des Ansehens der Katholischen Kirche dem Zentrum beigetreten waren, sondern die besonderen Grund zur Abneigung gegen die Reichsregierung oder einzelne Personen hatten. Beispielsweise war mein früherer Freund und Amtsgenosse v. Savigny eins der tätigsten Werkzeuge bei der Herstellung und Gründung des Zentrums, nachdem wir in persönlichem Unfrieden voneinander geschieden waren, aus Gründen, die nicht hierher gehören, und so mehrere andere Elemente, vor Allem die Welfen. Sie gaben allmählich dem Zentrum eine Färbung und eine Feindseligkeit gegen die Regierung und die Personen, welche gerade die Regierung zusammensetzten, die ursprünglich nicht mit Notwendigleit in dem alten Kampf zwischen Priester- und Königsherrschaft gelegen hatten, der auch hier zu Tage trat. Also ich fand die Schwierigkeiten, mit denen ich zu kämpfen hatte, sehr viel größer, als ich dachte. Ich habe mich nun immer nur gefragt, – nicht, was können wir erstreben und erlangen, was ist wünschenswert, – sondern: Was braucht der Staat absolut, um seine Funktionen weiter zu führen.
Innerlich habe ich stets zugegeben, daß das, was er nicht absolut braucht, nachgegeben und konzediert, abgeschafft werden könne, wenn der Gegner großen Wert darauf lege. Zu den absoluten Bedürfnissen konnte ich nun, wie ich schon erwähnte, eine Anzahl Einrichtungen, wie Priestererziehung, Ordenssachen, nicht rechnen. In Bezug auf alle Gravamina möchte ich den Gegnern, die auf demselben Stand punkte wie der Herr Vorredner stehen, antworten: Wir haben uns gar nicht zu fragen: was ist wünschenswert, was verdrießt uns in der ganzen Sache, was hätten wir anders gewünscht? sondern da, wo es sich um Aussöhnung zwischen zwei großen Bruchteilen des deutschen oder hier im Speziellen des preußischen Volks handelt, da müssen wir unseren katholischen Mitbürgern abgeben, was für uns entbehrlich ist. Nun, diese Stellung zur Sache habe ich nicht nur aus toleranter Denkungsweise, sondern sie drängt sich mir auf als Politiker; ich habe das Bedürfniß, die gemäßigten Katholiken, die den Streit lediglich um kirchlicher Glaubenssahen und nicht aus Fraktionszorn, aus Umsturzbedürfnissen führen, diese deutschfreundlichen und staatsfreundlichen Katholiken zufrieden zu stellen, wenn sie nicht zufrieden find. Das ist für mich ein Grund, ihren Wünschen möglichst näher zu treten, auch wenn ich gar nicht ein sehe, warum, da ich nicht dieselben Glaubensbedürfnisse habe. Mein Streben ist dabei lediglich das der Prophylaxis, der Befestigung der Einheit unserer gesamten deutschen Nation, im Hinblick auf die Gefahren, denen sie ausgesetzt sein wird in nicht zu langer Zeit, und im Hinblick auf die Versuche zu zentrifugalen Bestrebungen, die in kritischen Zeiten gemacht werden können, wenn Gründe vorhanden sind, welche die Einigkeit nicht gerade direkt stören, aber doch den Parteien, die durch und durch landes- und reichsfeindlich sind, Handhaben zur Einmischung geben.
Die Frage, ob wir mit unseren katholischen Landsleuten einig sind oder nicht, ist nicht auf das Innere beschränkt, sondern wirkt auch auf unsere äußeren Verhältnisse zurück. Daß unsere Verhältnisse zu Österreich besser find, wenn bei uns keine konfessionelle Streitfrage existiert, als sie auf die Dauer sein werden und sein können, wenn sie existiert, liegt auf der Hand. Ich will auf diesem Gebiete nur die eine Andeutung machen, die jeder, der die europäische Lage kennt, weiter durchdenken kann. Also auch das ist für mich ein Grund, nicht persönlich, sondern nach meinem Pflichtgefühl als verantwortlich für die Gesamtpolitik des Landes meinem Herrn gegenüber, – auch das ist ein Grund, warum ich den Frieden suche mit jedem Opfer, das ich vernünftigerweise bringen kann. In dieser Richtung hat sich eine lange Reihe von Korrespondenzen seit 1878 mit verschiedenen Kardinälen, mit Masella und Jacobini, bewegt, namentlich aber eine direkte Korrespondenz, mit der mich Seine Heiligkeit der Papst beehrt hat, und in der man allmählich den Friedensbestimmungen so weit nahe gekommen ist, daß wenigstens unnötige Hindernisse von keiner Seite mehr beigebracht wurden. Berechtigt ist ja allerdings der Einwand, den man mir macht, daß ich keine Bürgschaft dafür gewähren könne, daß der Friede mit dem Papst und mit der römischen Curie uns auch den Frieden im Lande gewähren werde. Das haben die jüngsten Vorgänge gezeigt, und die Führer des Centrums. haben ja schon den zwischen uns und dem Papst vorbereiteten Frieden von Hause aus verurteilt; sie haben in sehr harten und dürren Worten die Konzessionen, welche der Staat zu machen geneigt sei, als unannehmbar und ungenügend bezeichnet nach dem Rezept: Entweder alles oder gar nichts. Unter „allem“ verstehen sie natürlich die ausschließliche Herrschaft über unser Land, und die können wir ihnen nicht gewähren. Also wir sehen, daß gegen die Friedensbemühungen des Papstes im Zentrum und – bei dessen Wählern will ich nicht sagen – sondern bei dessen Wahlunternehmern, bei dem ganzen Gebäude oder Gewirre von Verbindungen, das bei den Wahlen entstanden ist, daß da eine Opposition gegen den Papst sich fühlbar gemacht hat. Man kann also sagen: Was hilft uns der Friede mit dem Papst, wenn Windthorst entschlossen ist, mit seinem Gefolge den Kampf in der bisherigen erbitterten Weise fortzusetzen und ihn, wenn hier Friede ist, auf dem Gebiete der Schule und sonst wieder anzufachen? Nun, da muß ich denn doch sagen, wenn wirklich ein Kampf vorhanden ist, wenn auf der einen Seite der Papst Leo XII. für den Frieden und für das Deutsche Reich eintritt, auf der anderen Seite das Zentrum und eine Anzahl mehr oder weniger demokratisierender Geistlicher sich den Wünschen des Papstes entgegenstellt, – wenn ich das als einen Kampf innerhalb der katholischen Kirche ansehen darf, so ist mir der Sieg des Papstes über kurz oder lang gar nicht zweifelhaft.
(Bravo!)
Es ist dazu nur notwendig, daß die regendichte Decke, möchte ich sagen, die eine Koalition zwischen der Wahrheit, die von oben kommt, und der misera contribuens plebs (das arme, steuerzahlende Volk) zu ziehen im Stande ist, allmählich durchweicht und die wählenden Massen dazu kommen, einzusehen, daß sie über die Wünsche, die Absichten des Papstes entweder wissentlich getäuscht oder sorgfältig im Dunkeln gehalten werden. Sobald sie das erkennen werden, wird die Opposition gegen den Papst, die jetzt in einzelnen Köpfen, ich möchte sagen, bis zu einer demokratischen Priesterrepublik sich aufbäumt, hinfällig werden; der Papst wird als Sieger im Felde bleiben, und wir haben ihn in diesem Kampfe meiner Überzeugung nach im Interesse der Autorität und Ordnung zu schützen und ihm beizustehen.
(Bravo!)
Ich habe bei einer anderen Gelegenheit gesagt, daß die Fortschrittspartei eine sehr gute Vorfrucht für die Sozialdemokratie sei. Wenn die Fortschrittspartei alle Mittel der klerikalen Agitation – ganz abgesehen von der Kaplanspresse oder auch der niedrigen Geistlichkeit – in die Hand bekommt, dann hat sie noch viel wirksamere Mittel, die klerikale Fortschrittspartei oder die klerikale Demokratie, die staatliche sowohl wie die päpstliche Autorität zu untergraben. In das Vacuum, welches dann eintritt, wenn die Autorität fehlt, tritt teilweise die priesterliche Gewalt des demokratisierenden Priesters; zum großen Teil aber tritt an die Stelle der päpstlichen Autorität die Sozialdemokratie, wo der Glaube geschwunden ist. Nun hat die Kaplanspresse eine langjährige Tätigkeit entwickelt, die weiter keinen Zweck hatte, als die preußische Regierung als unwürdig und unehrlich darzustellen und ihr die Autorität zu rauben. Die Leute, die diesen Raub an der Autorität begehen, sind nicht in der Lage, die Erbschaft anzutreten, sondern schaffen nur eine leere Hütte, in die die Sozialdemokratie eintritt; in dieser Beziehung halte ich die subversiven Tendenzen, das Unterwühlen der Autorität für vollständig gleichbedeutend, mag es von geistlicher oder weltlicher Seite, von Sozialdemokraten oder demokratisierenden Geistlichen ausgehen. Papst und Kaiser haben in dieser Beziehung das gleiche Interesse und müssen gegen Anarchie und Umsturz gleichmäßig Front machen.
(Bravo!)
Von dieser Überzeugung bin ich geleitet gewesen, wenn ich gegenüber den Wünschen des heutigen, friedliebenden, weisen und mit hoher politischer Einsicht begabten Papstes nachgiebiger gewesen bin, als ich voraussehen konnte, daß vielen meiner politischen Freunde lieb sein würde. Ich stehe für meine politische Überzeugung und meinen politischen Ruf ein, ohne in Abrede zu stellen, daß ich mich darin irren kann. Aber ich kann nur nach meiner Überzeugung handeln, und ich bin oft in meinem Leben in der Lage gewesen, daß ich einen anderen Ratgeber als mich selbst nicht gehabt habe. Das Zentrum an sich wäre, wenn es mit uns weiterkämpfen wollte, keine Majorität. Die Majorität, der Druck, den die Fraktion Windthorst auf die Regierung ausüben könnte, beruht ja mit auf dem Gewicht der politischen Intransigenten oder, wie man sie nannte, der Non-valeurs (Nicht-Werte), die zu jedem Feind der Regierung zu stehen bereit sind, und auf dem Bündniß der Fortschrittspartei. Nach Abzug der Fortschrittspartei schwand die beherrschende Stellung ihres Chefs, des Dr. Windthorst. Nun ist ja ein Majoritätsverhältniß eingetreten, bei dem dieser Windthorstliche Druck von der Reichsregierung genommen ist. Aber wer möchte dafür bürgen, daß wir über drei Jahre das wieder haben?
Bei der Leichtigkeit, das Volk zu belügen, bei der ungeheuren Gewissenlosigkeit im Belügen des Volkes, bei diesem ganzen Arbeiten der Wahlmaschine – wer bürgt uns, daß nicht irgendeine verlogene Behauptung gegen die Regierung gerade bei den nächsten Wahlen aufkommt, und daß es dann nicht wieder anders steht. Wir können darauf keine Häuser bauen, und ich kann daraus, daß inzwischen die Majorität im Reichstage eine regierungsfreundliche geworden ist, keinen Grund entnehmen, dem Papst nicht Wort zu halten. – wenigstens ich für meine Person – in Allem, was ich ihm zur Zeit einer anderen, regierungsfeindlichen Majorität konzediert hatte. Das ändert in dem Verhalten der Regierung Nichts, ob wir jetzt eine Majorität haben oder nicht. Ich sehe voraus, daß wir im anderen Hause, und vielleicht auch in diesem, harten Tadel darüber auszuhalten haben werden. Ich hoffe aber, daß das nicht tiefer wirken wird, als zur Befriedigung des Bedürfnisses einer überzeugten Kritik, die der Aussprache bedarf.
Ich muß in Bezug auf das Verhalten der deutschen Geistlichkeit in diesem Kampf noch erwähnen, daß wir, als wir das Vatikanum kommen sahen und es bekämpften, uns sagten: Der Schaden, den wir dadurch erleiden, besteht darin, daß unsere deutschen Bischöfe unselbständiger werden, und von diesen erwarten wir doch da, wo das Interesse des preußischen Staats in Frage kommt, vorzugsweise eine Vertretung desselben gegen päpstliche Übergriffe. Wir hatten damals ein Vertrauen zu unserem deutschen Episkopat, welches sich leider nicht in allen Fällen bewährt hat. Wir sind setzt in der umgekehrten Lage, daß wir die Hilfe des Papstes in Rom gegen Einwirkungen unseres deutschen Episkopats brauchen. Der Landsmann läßt den Landsmann im Stich. Es ist ja eine alte historische und betrübende Wahrheit, daß es eine größere Kampfesfreude für den kampfesmutigen Deutschen überhaupt nicht gibt, als den Streit mit dem eigenen Landsmann.
Mit der römischen Curie zweifle ich nicht an der Versöhnung; aber wenn der unbeschäftigte deutsche Landsmann, wozu ich ... nun, ich will nicht aufzählen, wen ich dazu rechne,
(Heiterkeit.)
wenn der einen ihm teuer gewordenen Streit und Zorn aufgeben muß und die Hand zur Versöhnung bieten, dann wird ihm die Freude am Leben verdorben.
(Heiterkeit.)
Der Streit mit dem Landsmann ist ja ein nationaler Sport, wie bei uns, so auch bei anderen Völkern der Welt; ein Bürgerkrieg ist immer das Fürchterlichste, was man haben kann, in allen Ländern; aber bei uns Deutschen noch fürchterlicher, weil er von uns mit mehr Liebe durchgefochten wird, wie jeder andere Krieg. Deshalb weiß ich auch nicht, ob wir durch den Frieden mit Rom zum Frieden mit dem Zentrum kommen. Aber wenn wir den Frieden mit Rom entweder vollständig haben, oder so weit, daß wir eben von beiden Seiten den Raum, der uns trennt, vollständig übersehen können als etwas weniger ins Gewicht Fallendes, dann fürchte ich den Kampf mit dem Zentrum und Welfen nicht mehr – ich fürchte ihn überhaupt nicht –, aber er ist mir dann nicht mehr von der Wichtigkeit, daß ich deshalb irgendwie die Gesetzgebung in Anspruch nehmen sollte. Ich glaube, er wird austrocknen wie eine Hochflut nach dem Gewitter, und ehrbare und friedliche Leute werden sich allmählich von diesem Kampfe zurückziehen. Wenn wir auch nicht den Frieden auf einmal von einem bestimmten Datum erlangen, so glaube ich doch, daß, sobald Papst und König ihrerseits über die Beziehungen einig find, wie sie es heute in der Hauptsache sind, daß wir dem, was uns Windthorst und das Zentrum an Kampf zu bringen hat, mit Ruhe entgegen sehen können.
(Bravo!)
Zu dieser Ruhe zu gelangen, möchte ich das Hohe Haus um die Annahme der Vorlage und derjenigen Amendements bitten, die der Herr Kultusminister befürworten wird, da ich mich auf diese Spezialverhältnisse nicht einlassen will.
(Lebhafter Beifall.)