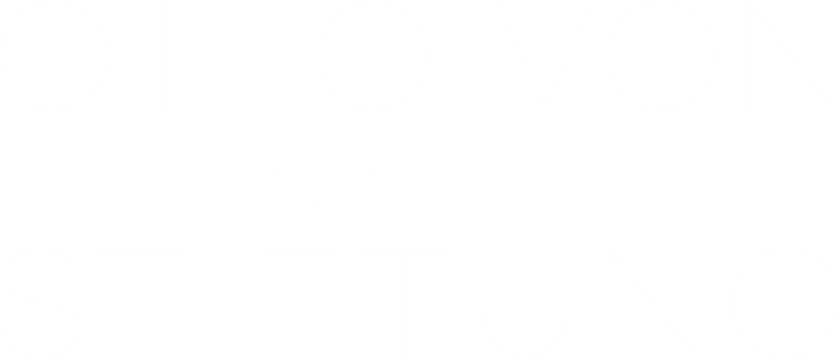Rede im Reichstag, Berlin
14. Mai 1872
Bismarck lehnt die Anregung der Liberalen zur Einsparung der diplomatischen Vertretung beim Vatikan ab. Er sieht aber auch keine Möglichkeit zu einer Annäherung an die Kurie. Im Konflikt mit der katholischen Kirche nachzugeben, kommt für ihn dem Bittgang des Königs Heinrich IV. zu Papst Gregor VII. im Jahre 1077 gleich. „Seien Sie außer Sorge: Nach Kanossa gehen wir nicht – weder körperlich noch geistig!“
Ich begreife, daß bei dieser Budgetposition der Gedanke entstehen kann, daß die Kosten für diese Gesandtschaft nicht mehr erforderlich seien, weil es sich nicht mehr um einen Schutz deutscher Untertanen in den betreffenden Landesteilen handelt. Ich freue mich aber doch, daß ein Antrag auf Absetzung dieser Position nicht gestellt ist, denn er würde der Regierung unwillkommen gewesen sein. Die Aufgaben einer Gesandtchaft bestehen ja einerseits im Schutze ihrer Landsleute, andererseits aber doch auch in der Vermittlung der politischen Beziehungen, in welchen die Reichsregierung zu dem Hofe, bei dem ein Gesandter akkreditiert ist, steht. Nun gibt es keinen auswärtigen Souverän, der nach der bisherigen Lage unserer Gesetzgebung berufen wäre, so ausgedehnte, der Souveränität nahe kommende und durch keine konstitutionelle Verantwortlichkeit gedeckte Rechte innerhalb des Deutschen Reiches vermöge unserer Gesetzgebung zu üben. Es ist daher für das Deutsche Reich von wesentlichem Interesse, wie dasselbe sich zu dem Oberhaupte der römischen Kirche, welches diese, für einen auswärtigen Souverän so ungewöhnlich umfangreiche Einflüsse bei uns ausübt – wie es sich auf diplomatischem Wege dazu stellt. Ich glaube kaum, daß es einem Gesandten des Deutschen Reiches nach den jetzt in der katholischen Kirche maßgebenden Stimmungen gelingen würde, durch die geschickteste Diplomatie, durch Überredung – von komminatorischen Haltungen, wie sie zwischen zwei weltlichen Mächten Vorkommen können, kann ja hier nicht die Rede sein – aber ich will sagen durch Überredung einen Einfluß auszuüben, der eine Modifikation der von Seiner Heiligkeit dem Papste zu den weltlichen Dingen prinzipiell genommenen Stellung herbeizuführen imstande sein würde. Ich halte es nach den neuerdings ausgesprochenen und öffentlich promulgierten Dogmen der katholischen Kirche nicht für möglich für eine weltliche Macht, zu einem Konkordat zu gelangen, ohne daß diese weltliche Macht bis zu einem Grade und in einer Weise effaziert würde, die das Deutsche Reich wenigstens nicht annehmen kann. (Sehr wahr!)
Seien Sie außer Sorge: Nach Kanossa gehen wir nicht – weder körperlich noch geistig! (Lebhaftes Bravo!)
Aber nichtsdestoweniger kann sich niemand verhehlen, daß die Lage des Deutschen Reiches – ich habe hier nicht die Aufgabe, die Motive und die Schuld der einen oder der anderen Seite zu untersuchen, sondern nur die Aufgabe, eine Budgetposition zu verteidigen – daß die Stimmung innerhalb des Deutschen Reiches auf dem Gebiete des konfessionellen Friedens eine getrübte ist. Die Regierungen des Deutschen Reiches suchen emsig, suchen mit der ganzen Sorgfalt, die sie ihren katholischen wie ihren evangelischen Untertanen schulden, nach den Mitteln, um in einer möglichst friedlichen, in einer die konfessionellen Verhältnisse des Reichs möglichst wenig erschütternden Weise aus diesem jetzigen Zustande in einen annehmlicheren zu gelangen. Es wird dies ja schwerlich anders geschehen können als auf dem Wege der Gesetzgebung, und zwar auf dem Wege einer allgemeinen Reichsgesetzgebung (Bravo!), zu welcher die Regierungen genötigt werden, die Beihilfe des Reichstages in Anspruch zu nehmen. (Bravo! Hört! Hört!)
Daß aber diese Gesetzgebung in einem für die Gewissensfreiheit durchaus schonenden Wege, in der zurückhaltendsten, zartesten Weise vorgehen, daß dabei die Regierung bemüht sein muß, sorgfältig alle die unnötigen Erschwerungen ihrer Aufgaben zu verhüten, die aus unrichtigen Berichterstattungen, aus dem Mangel an richtigen Formen hervorgehen können, das werden Sie mir zugeben; daß die Regierungen bemüht sein müssen, die Richtigstellung unseres inneren Friedens auf die für die konfessionellen Empfindungen, auch solche, die wir nicht teilen, schonendste Weise herbeizuführen, werden Sie mir zugeben. Dazu gehört vor allen Dingen, daß auf der einen Seite die römische Kurie jederzeit nach Möglichkeit gut unterrichtet sei über die Intentionen der deutschen Regierungen, und besser unterrichtet sei, als man es bisher gewesen ist. Ich halte für eine der hervorragendsten Ursachen der gegenwärtigen Trübungen auf konfessionellem Gebiete die unrichtige, entweder durch eigene Aufregung oder durch schlimmere Motive getrübte Darstellung über die Lage der Dinge in Deutschland und Intentionen der deutschen Regierungen, die an Seine Heiligkeit den Papst gelangt sind.
Ich hatte gehofft, daß durch die Wahl eines Botschafters, der von beiden Seiten volles Vertrauen hatte, einmal in Bezug auf seine Wahrheitsliebe und Glaubwürdigkeit, dann in Bezug auf die Versöhnlichkeit seiner Gesinnungen und Haltung, daß die Wahl eines solchen Botschafters, wie sie Seine Majestät der Kaiser in der Person eines bekannten Kirchenfürsten [Kardinal Hohenlohe-Schillingsfürst] getroffen hatte, in Rom willkommen sein werde, daß sie als ein Pfand unserer friedlichen, entgegenkommenden Gesinnungen aufgefaßt, daß sie als eine Brücke der Verständigung benutzt werden würde; ich hatte gehofft, daß man darin die Versicherung erkennen würde, daß wir etwas anderes, als das, was ein Seiner Heiligkeit dem Papste auch durch die intimsten Beziehungen verbundener Kirchenfürst sagen, vortragen und ausdrücken könnte, nie von Seiner Heiligkeit dem Papste verlangen würden, daß die Formen immer diejenigen bleiben würden, in welchen ein Kirchenfürst dem andern gegenüber sich bewegt, und daß alle unnötigen Reibungen in einer Sache, die an sich schwierig genug ist, verhütet würden. Man hat an diese Ernennung manche Befürchtungen auf evangelischer und liberaler Seite geknüpft, die meines Erachtens in einer unrichtigen Würdigung der Stellung eines Gesandten oder Botschafters überhaupt bestehen.
Ein Gesandter ist wesentlich doch nur das Gefäß, welches durch die Instruktionen seines Souveräns gefüllt, erst seinen vollen Wert bekommt. Daß aber das Gefäß ein angenehmes, willkommenes sei, ein solches, welches nach seiner Beschaffenheit, wie man von alten Krystallen sagte, Gift oder Galle in sich nicht aufnehmen kann, ohne es sofort anzuzeigen, das ist allerdings wünschenswert in so delikaten Beziehungen, wie diese sind. Das hatten wir gehofft zu erreichen. Leider ist aus Gründen, die uns noch nicht dargelegt sind, diese Intention der kaiserlichen Regierung durch eine kurze Ablehnung von seiten der päpstlichen Kurie verhindert worden, zur Ausführung zu gelangen. Ich kann wohl sagen, daß ein solcher Fall nicht häufig vorkommt. Es ist üblich, daß, wenn ein Souverän seine Wahl zu einem Gesandten, zu einem Botschafter getroffen hat, er dann aus Courtoisie an den Souverän, bei dem der Gesandte akkreditiert werden soll, die Frage richtet, ob dieser ihm persona grata sei, es ist indes ganz außerordentlich selten der Fall, daß diese Frage verneint wird, da es doch immer ein Rückgängigmachen einer einmal geschehenen Ernennung bedingt; denn was der Kaiser zu einer solchen Ernennung tun kann, tut er vorher, ehe er anfragt. Also er hat ernannt, ehe er anfragt, die verneinende Antwort ist also eine Forderung, das Geschehene zurückzunehmen, eine Erklärung: du hast unrichtig gewählt! Ich bin seit ziemlich zehn Jahren jetzt Auswärtiger Minister, ich bin seit 21 Jahren in den Geschäften der höheren Diplomatie, und ich glaube mich nicht zu täuschen, wenn ich sage, es ist dies der einzige und erste Fall, den ich erlebt (hört! hört!), daß eine solche Frage verneinend beantwortet wird.
Ich habe öfter schon erlebt, daß Bedenken ausgesprochen sind gegen Gesandte, die bereits längere Zeit fungiert hatten, daß ein Hof in vertraulicher Weise den Wunsch ausgesprochen hat, daß ein Wechsel in der Person erfolgen möge; dann aber hatte dieser Hof eine mehrjährige Erfahrung im diplomatischen Verkehr mit dieser Person hinter sich, hatte die Überzeugung, daß diese Persönlichkeit zur Sicherung der von dem Hofe gewünschten guten Beziehungen nicht geeignet sei, und äußert dann in der vertraulichsten Form, gewöhnlich in eigenhändigem Schreiben von Souverän zu Souverän mit Erläuterungen, warum dies geschehen – und dennoch in einer sehr vorsichtigen Weise; es wird selten oder nie bestimmt gefordert. Es sind ja in der neuesten Zeit einzelne, wenigstens ein recht flagrantes Beispiel vorgekommen, daß die Abberufung eines Gesandten gefordert wird, aber, wie gesagt, die Versagung eines neu zu ernennenden ist mir nicht erinnerlich, daß ich sie schon erlebt habe.
Mein Bedauern über diese Ablehnung ist ein außerordentlich lebhaftes; ich bin aber nicht berechtigt, dieses Bedauern in die Farbe einer Empfindlichkeit zu übersetzen, denn die Regierung schuldet unseren katholischen Mitbürgern, daß sie nicht müde werde, die Wege aufzusuchen, auf denen die Regelung der Grenze zwischen der geistlichen und weltlichen Gewalt, der wir im Interesse unseres inneren Friedens absolut bedürfen, in der schonendsten und konfessionell am wenigsten verstimmenden Weise gefunden werden könne. Ich werde deshalb mich durch das Geschehene nicht entmutigen lassen, sondern fortfahren, bei Seiner Majestät dem Kaiser dahin zu wirken, daß ein Vertreter des Reiches für Rom gefunden wird, welcher sich des Vertrauens beider Mächte, wenn nicht in gleichem Maße, doch in einem hinlänglichen Maße, für sein Geschäft erfreut. Daß diese Aufgabe durch das Geschehene wesentlich erschwert ist, kann ich allerdings nicht verhehlen. (Bravo!)
Der Zentrumsabgeordnete Windthorst weist darauf hin, dass Hohenlohe es verabsäumt habe, beim Papst als seinem Dienstherrn vorstellig zu werden. Bismarck erwidert darauf:
Der Herr Redner ist über den Gegenstand, um den es sich hier handelt, zu meiner Genugtuung, wie aus den letzten wenigen Worten seiner Rede hervorging, mit mir vollständig einverstanden. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, so wünscht auch er die Beibehaltung der Gesandtschaft beim römischen Stuhle. Ich könnte mich mit der Konstatierung dieses Einverständnisses begnü-gen, wenn nicht die Art, wie er dasselbe motiviert, mir zu einigen sachlichen Bemerkungen und Rektifikationen Anlaß gäbe.
Der Herr Redner hat in Beziehung auf die kürzlich von uns versuchte Ernennung eines Botschafters beim heiligen Stuhle seine Verwunderung darüber ausgesprochen, daß der dazu designierte Kardinal nicht nach Rom gegangen sei, um sich die Antwort zu holen. In der Sache waren indes zwei Antworten zu geben: die eine an Seine Majestät den Kaiser, der durch seine amtlichen Organe bei der römischen Kurie anfragt: „Ist Euch das recht?“ – die zweite an den Kardinal. Wenn ich richtig berichtet bin, so ist die Antwort an den Herrn Kardinal, das Verbot der Annahme enthaltend, schon sehr viel früher als die Antwort an Seine Majestät den Kaiser erfolgt. Nachdem ich hiervon überzeugt war, schien es mir doch nötig, daß Seine Majestät der Kaiser an Seiner Seite auch eine Antwort erhalte, und infolgedessen habe ich späterhin – ich weiß nicht, ob fünf oder acht Tage nach der ersten Anfrage – den Wunsch ausdrücken lassen, daß wir auch eine Antwort erhalten möchten. Die haben wir bekommen. Die Aktenstücke, die in den Zeitungen gedruckt sind, soviel ich den Abdruck habe sehen können – ich habe nicht nochmal gelesen, was ich kannte – werden authentisch sein; den Artikel, mit dem sie verbrämt sind, kenne ich nicht.
Ich möchte auf die persönliche Kritik Seiner Eminenz des Kardinals, die der Herr Vorredner hier auf der Tribüne ansprach, nicht eingehen; nur auf das Wort „Dienstherr“ möchte ich doch mit einem Worte zurückkommen. Der Herr Vorredner ist in der Geschichte gewiß bewandert – soweit sie die kirchlichen Verhältnisse berührt (Heiterkeit) – und da erlaube ich mir die Frage, wer der Dienstherr des Kardinals Richelieu, des Kardinals Mazarin war. Beide Herren haben im Dienste ihres Souveräns, des Königs von Frankreich, recht wesentliche Streitfragen, obwohl sie Kardinäle waren, mit dem Römischen Stuhle zu erledigen und zu verfechten gehabt. Also so ganz durchschlagend ist der Vergleich mit einem Generaladjutanten und dem Kardinal doch nicht, obschon ich, wenn es Seiner Heiligkeit gefiele, hier einen Generaladjutanten Seiner Majestät zum Nuntius zu ernennen, Seiner Majestät unbedingt zureden würde, ihn zu akzeptieren. (Große, anhaltende Heiterkeit.)
Der Herr Vorredner hat es bemängelt, daß diese ganzen Verhandlungen früher in die Öffentlichkeit gelangt wären, als mit der von mir beanspruchten dienstlichen Verschwiegenheit im auswärtigen Dienst verträglich wäre. Ich kann nur aktenmäßig nachweisen, daß unsererseits keine Veröffentlichung früher stattgefunden hat, als bis ich von Rom das Telegramm von unserer dortigen Gesandtschaft amtlich erhielt: Die päpstliche Kurie macht aus der Ablehnung kein Geheimnis und hat dem und dem fremden Gesandten unumwunden Mitteilung davon gemacht. (Hört! Hört!)
Von dem Augenblicke an war es überflüssig, das Geheimnis zu bewahren. Ich glaube auch, daß es bis dahin der Presse gegenüber gewahrt ist. Ich habe Indizien, daß es Rom gegenüber schon vorher nicht gewahrt worden ist. Wie es so früh ruchbar werden konnte, darüber hatte ich, als der Herr Vorredner diesen Punkt berührte, eine leise Hoffnung, er werde mir seinerseits Aufklärung geben (Heiterkeit), wie dieses Dienstgeheimnis so früh hat kolportiert werden können. Ich weiß nicht, ob die Sache etwa die Entwicklung nehmen kann, daß auf sein Zeugnis darüber dermaleinst zurückgegriffen werden wird. Sollte es mir aber gelingen, die Quelle der Indiskretion zu entdecken, so kann ich nach den mir mündlich zugekommenen Indizien versichern, daß ich auf das Zeugnis des Herrn Vorredners vor Gericht provozieren würde.
Der Herr Vorredner fragt: „Wie ist es zugegangen, daß das sofort bekannt geworden ist?“ Ja, dieselbe Frage gebe ich ihm zurück und bin überzeugt, er weiß mehr davon, als ich. (Bewegung.)
Der Herr Vorredner hat in mehr als einer Beziehung meine Absichten, die ich vorhin andeutete und die ja nicht die der verbündeten Regierungen sind, sondern die ich nur als meine persönlichen bezeichnen kann – da ich aber eine Persönlichkeit von Einfluß in diesen Sphären bin, so ist es immerhin von Interesse, bei dieser Diskussion meine Ansichten kundzugeben und den Nachweis zu liefern, inwieweit man sich etwa diametral entgegenarbeitet oder nicht. Der Herr Vorredner hat die Hoffnung ausgesprochen, daß man durch Vertrag zu einer Regelung der bei uns streitigen Angelegenheiten gelangen werde, und hat auch, wenn ich ihn richtig verstanden habe, Andeutungen über das Bestehen von Verträgen gemacht, die ich nicht ganz begründet finden kann. Es ist schon oft ein Streit gewesen, ob man bestimmten Einrichtungen einen vertragsmäßigen Charakter beilegen kann oder nicht. Aber ich bin ein Feind aller Konjekturalpolitik und aller Prophezeiungen – das wird sich ja finden –, nur das kann ich dem Herrn Vorredner versichern, daß wir gegenüber den Ansprüchen, welche einzelne Untertanen Seiner Majestät des Königs von Preußen geistlichen Standes stellen, daß es Landesgesetze geben könne, die für sie nicht verbindlich seien, daß wir solchen Ansprüchen gegenüber die volle einheitliche Souveränität mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln aufrechterhalten werden (Bravo!) und in dieser Richtung auch der vollen Unterstützung der großen Majorität beider Konfessionen sicher sind. (Lebhaftes Bravo!)
Die Souveränität kann nur eine einheitliche sein und muß es bleiben: die Souveränität der Gesetzgebung! Und wer die Gesetze seines Landes als für ihn nicht verbindlich darstellt, stellt sich außerhalb der Gesetze und sagt sich los von dem Gesetz! (Sehr gut! Sehr richtig!)
Ich habe dem Herrn Vorredner als Minister in dieser Beziehung weiter nichts zu sagen; als evangelischer Christ aber habe ich ihm noch zu sagen: wenn er glaubt, daß die Trennung der evangelischen Kirche vom Staate für die evangelische Kirche tödlich sei, so muß ich ihm, was ich seiner ganzen Haltung nach voraussehen konnte, entgegnen, daß ihm zu meinem Bedauern der wahre Begriff des Evangeliums noch nicht aufgegangen ist!