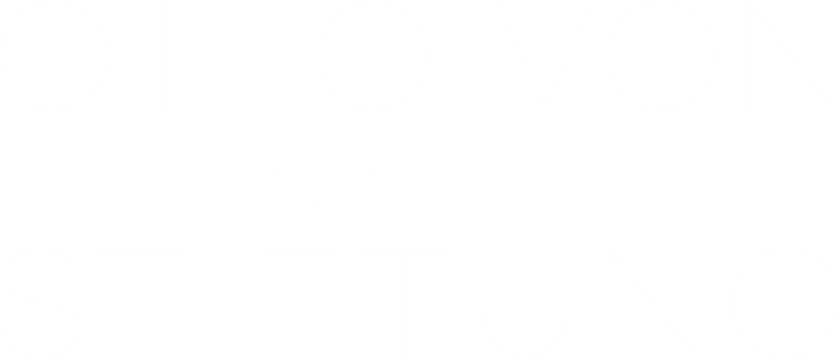Rede im Ersten Vereinigten Landtag, Berlin
15. Juni 1847
In einer Debatte über ein neues preußisches Judengesetz betont Bismarck, „kein Feind der Juden“ zu sein. Er gesteht ihnen die volle bürgerliche Rechtsgleichheit mit Ausnahme des Rechts zu, „in einem christlichen Staate ein obrigkeitliches Amt zu bekleiden“. Gleichzeitig fordert er sie auf, „die Schranken nieder[zu]reißen, die sie von uns trennten“.
Wenn ich heute diese Stelle betrete, so geschieht es mit größerer Befangenheit als sonst, da ich fühle, daß ich durch das, was ich sagen werde, einigen nicht ganz schmeichelhaften Äußerungen gestriger Redner gewissermaßen in den Wurf laufe. Ich muß öffentlich bekennen, daß ich einer Richtung angehöre, die der geehrte Abgeordnete von Krefeld gestern als finster und mittelalterlich bezeichnete, derjenigen Richtung, welche es nochmals wagt, der freieren Entwickelung des Christentums wie sie der Abgeordnete von Krefeld für die einzig wahre hält, entgegenzutreten. Ich kann ferner nicht leugnen, daß ich jenem großen Haufen angehöre, welcher, wie der geehrte Abgeordnete aus Posen [Beckerath] bemerkte, dem intelligenteren Teile der Nation gegenübersteht und diesem intelligenteren Teile in, wenn mein Gedächtnis mich nicht täuscht, ziemlich geringschätzender Weise entgegengesetzt wurde, dem großen Haufen, welcher noch an Vorurteilen klebt, die er mit der Muttermilch eingesogen hat, dem Haufen, welchem ein Christentum, das über dem Staate steht, zu hoch ist.
Wenn ich mich in der Schußlinie so scharfer Vorwürfe ohne Murren befinde, so glaube auch ich die Nachsicht der hohen Versammlung in Anspruch nehmen zu dürfen, wenn ich mit derselben Offenheit, welche die Äußerungen meiner Gegner charakterisiert, bekenne, daß es mir gestern in manchen Augenblicken von Zerstreutheit nicht ganz gegenwärtig blieb, ob ich mich in einer Versammlung befände, für deren Mitglieder das Gesetz hinsichtlich der Wählbarkeit die Bedingung der Gemeinschaft mit einer der christlichen Kirchen aufstellt. Ich gehe zur Sache selbst über. Die meisten Redner haben über das vorliegende Gesetz sich weniger ausgesprochen, als über die Emanzipation im allgemeinen. Ich folge diesem Wege. Ich bin kein Feind der Juden, und wenn sie meine Feinde sein sollten, so vergebe ich ihnen. Ich liebe sie sogar unter Umständen. Ich gönne ihnen auch alle Rechte, nur nicht das, in einem christlichen Staate ein obrigkeitliches Amt zu bekleiden.
Über den Begriff eines christlichen Staates haben wir von dem Herrn Minister des Schatzes [Thile] und von einem andern Herrn auf der Ministerbank [Brüggemann] Worte gehört, die ich fast ganz unterschreibe; dagegen haben wir auch gestern gehört, daß der christliche Staat eine müßige Fiktion, eine Erfindung neuerer Staatsphilosophen sei. Ich bin der Meinung, daß der Begriff des christlichen Staats so alt sei, wie das ci-devant heilige römische Reich, so alt, wie sämtliche europäische Staaten, daß er gerade der Boden sei, in welchem diese Staaten Wurzel geschlagen haben, daß jeder Staat, wenn er seine Dauer gesichert sehen, wenn er die Berechtigung zur Existenz nur nachweisen will, sobald sie bestritten wird, auf religiöser Grundlage sich befinden muß. Für mich sind die Worte: „Von Gottes Gnaden“, welche christliche Herrscher ihrem Namen beifügen, kein leerer Schall, sondern ich sehe darin das Bekenntnis, daß die Fürsten das Zepter, welches ihnen Gott verliehen hat, nach Gottes Willen auf Erden führen wollen. Als Gottes Willen kann ich aber nur erkennen, was in den christlichen Evangelien offenbart worden ist, und ich glaube in meinem Rechte zu sein, wenn ich einen solchen Staat christlich nenne, welcher sich die Aufgabe gestellt hat, die Lehre des Christentums zu realisieren, zu verwirklichen. Daß dies unserm Staate nicht in allen Beziehungen gelingt, das hat gestern der geehrte Abgeordnete aus der Grafschaft Mark [Vincke] in einer mehr scharfsinnigen als meinem religiösen Gefühle wohltuenden Parallele zwischen den Wahrheiten des Evangeliums und den Paragraphen des Landrechts dargetan. Wenn indes auch die Lösung nicht immer gelingt, so glaube ich doch, die Realisierung der christlichen Lehre sei der Zweck des Staates; daß wir aber mit Hilfe der Juden diesem Zwecke näher kommen sollten als bisher, kann ich nicht glauben.
Erkennt man die religiöse Grundlage des Staates überhaupt an, so glaube ich, kann diese Grundlage bei uns nur das Christentum sein. Entziehen wir diese Grundlage dem Staate, so behalten wir als Staat nichts als ein zufälliges Aggregat von Rechten, eine Art Bollwerk gegen den Krieg aller gegen alle, welchen die ältere Philosophie aufgestellt hat. Seine Gesetzgebung wird sich dann nicht mehr aus dem Urquell der ewigen Wahrheit regenerieren, sondern aus den vagen und wandelbaren Begriffen von Humanität, wie sie sich gerade in den Köpfen derjenigen, welche an der Spitze stehen, gestalten. Wie man in solchen Staaten den Ideen z.B. der Kommunisten über die Immoralität des Eigentums, über den hohen sittlichen Wert des Diebstahls als eines Versuchs, die angeborenen Rechte der Menschen herzustellen, das Recht, sich geltend zu machen, bestreiten will, wenn sie die Kraft dazu in sich fühlen, ist mir nicht klar; denn auch diese Ideen werden von ihren Trägern für human gehalten und zwar als die rechte Blüte der Humanität angesehen. Deshalb, meine Herren, schmälern wir dem Volke nicht sein Christentum, indem wir ihm zeigen, daß es für seine Gesetzgeber nicht erforderlich sei; nehmen wir ihm nicht den Glauben, daß unsere Gesetzgebung aus der Quelle des Christentums schöpfe, und daß der Staat die Realisierung des Christentums bezwecke, wenn er auch diesen Zweck nicht immer erreicht!
Ich gehe von der Theorie der Frage auf einige praktische Momente über. In den Landesteilen, wo das Edikt von 1812 gilt, fehlen den Juden, soviel ich mich erinnere, keine anderen Rechte, als dasjenige, obrigkeitliche Ämter zu bekleiden. Dieses nehmen sie nun in Anspruch, sie verlangen, Landräte, Generale, Minister, ja unter Umständen auch Kultusminister zu werden. Ich gestehe ein, daß ich voller Vorurteile stecke, ich habe sie, wie gesagt, mit der Muttermilch eingesogen, und es will mir nicht gelingen, sie wegzudisputieren; denn wenn ich mir als Repräsentanten der geheiligten Majestät des Königs gegenüber einen Juden denke, dem ich gehorchen soll, so muss ich bekennen, daß ich mich tief niedergedrückt und gebeugt fühlen würde, daß mich die Freudigkeit und das aufrechte Ehrgefühl verlassen würden, mit welchen ich jetzt meine Pflichten gegen den Staat zu erfüllen bemüht bin. Ich teile diese Empfindung mit der Waffe der niederen Schichten des Volkes und schäme mich dieser Gesellschaft nicht.
Warum es den Juden nicht gelungen ist, in vielen Jahrhunderten sich die Sympathie der Bevölkerung in höherem Grade zu verschaffen, das will ich nicht genau untersuchen; ein geehrter Redner aus der Grafschaft Mark hat die Gründe schärfer herausgestellt, als ich sie hier wiederholen möchte. Nur eins ist mir nicht klar geworden, nämlich wie der geehrte Redner diejenigen Leute, die er, wenn ich richtig verstand, als zu schlecht für seinen Umgang bezeichnete, zu seinen vorgesetzten Beamten, selbst zu Ministern haben möchte, wenn er es nicht braucht. Der geehrte Redner sprach die Überzeugung aus, daß die Juden, seien sie auch jetzt, was sie wollten, sich ändern könnten und würden, und führe zum Beweise dessen an, was sie früher gewesen seien. Darauf muss ich erwidern, daß wir es nicht mit den Makkabäern der Vorzeit, noch mit den Juden der Zukunft zu tun haben, sondern mit den Juden der Gegenwart, wie sie jetzt sind. Darüber, wie sie sind, will ich mir in Pausch und Bogen kein Urteil erlauben. Ich gestehe zu, daß in Berlin und überhaupt größeren Städten die Judenschaft fast durchaus aus achtungswerten Leuten besteht; ich gebe zu, daß solche auch auf dem Lande nicht bloß zu den Ausnahmen gehören, obgleich ich sagen muß, daß der entgegengesetzte Fall vorkomme. Wir haben gestern von der Mildtätigkeit der Juden zur Unterstützung ihrer Sache gehört. Nun, Beispiel gegen Beispiel – ich will ein anderes geben, ein Beispiel, in welchem eine ganze Geschichte der Verhältnisse zwischen Juden und Christen liegt. Ich kenne eine Gegend, wo die jüdische Bevölkerung auf dem Lande zahlreich ist, wo es Bauern gibt, die nichts ihr Eigentum nennen auf ihrem ganzen Grundstück; von dem Bette bis zur Ofengabel gehört alles Mobiliar dem Juden, das Vieh im Stall gehört dem Juden, und der Bauer zahlt jedes einzelne seine tägliche Miete; das Korn auf dem Felde und in der Scheune gehört dem Juden, und der Jude verkauft dem Bauer das Brot, Saat- und Futterkorn metzenweis. Von einem ähnlichen christlichen Wucher habe ich, wenigstens in meiner Praxis, noch nie gehört! Man führt zur Entschuldigung dieser Fehler an, daß sie aus den gedrückten Verhältnissen der Juden notwendig hervorgehen müßten. Wenn ich mir die Reden von gestern vergegenwärtige, so möchte ich glauben, daß wir in den Zeiten der Judenhetzen lebten, daß sich jeder Jude täglich alles das müsse gefallen lassen, was der ehrliche Shylock erdulden wollte, wenn er nur reich würde. Aber davon sehe ich nirgends etwas, sondern ich sehe nur, wie gesagt, daß der Jude nicht Beamter werden kann, und nun ist mir doch das eine starke Schlußfolge, daß, weil jemand nicht Beamter werden kann, er ein Wucherer werden müsse. Einer der Abgeordneten der pommerschen Ritterschaft [Gottberg] ist so weit gegangen, zu behaupten, daß die Juden von jeder edleren Beschäftigung, mit Ausnahme des Handels, ausgeschlossen seien. Das einzige aber, wovon sie ausgeschlossen sind, ist der Hafen der Bureaukratie, und ich appelliere an den geehrten Redner selbst, ob er in seiner Behauptung nicht zu weit geht, indem darin liegt, daß nur das Beamtentum und der Handel edle Beschäftigungen sein sollen. Einem anderen Redner der schlesischen Ritterschaft [Renard] möchte ich mich für die Folge seiner Rede anschließen, wenn er nur den Schluß seiner Rede als integrierenden Teil derselben stets beibehalten will. Er will die Juden emanzipieren, wenn sie selbst die Schranken niederreißen, die sie von uns trennen. Die hohe Versammlung hat sich gestern einige Anekdoten vorlesen lassen, sie wird also auch mir gestatten, eine zu erzählen, durch welche ich darzutun suche, wie wenig die Juden geneigt sind, von der Starrheit ihrer Gebräuche zu lassen.
Ein jüdischer Gelehrter von hohem Ansehen, den ich nicht nennen will, den ich aber privatim jedem der Anwesenden nennen werde, der es zu wissen verlangt, den viele von uns kennen, und der in einer der größeren Städte des Staates wohl angesehen ist, hält so fest an den alten Satzungen, daß er es nicht wagte, am Sabbat etwas zu tragen, nicht einmal ein Schnupftuch in der Tasche. Dieser Mangel war für ihn mit Unbequemlichkeiten verknüpft, gegen die er in den rabbinischen Büchern nun folgenden Ausweg fand. Ich erzähle, wie es mir ein Jude selbst mitgeteilt hat. Es soll erlaubt sein, etwas zu tragen am Sabbat an einem Orte, der dem Träger persönlich gehört. Ferner stellt eine andere rabbinische Lehre, wie ich gehört habe, den Grundsatz auf, daß ein Beamter des Königs denselben so weit vertrete, daß Veräußerungen von königlichem Eigentum, welche ein solcher Beamter vornimmt, Gültigkeit haben. Der gedachte Gelehrte ließ sich also einen Unterbeamten der Polizei kommen, kaufte von diesem für einen Taler im Scheinkauf die Wohnung des Beamten mit allen Umgebungen derselben, auf welche sich das Dispositionsrecht des Beamten etwa erstrecken können, also die ganze Stadt des Königs, und seitdem trägt er sein Schnupftuch mit gutem Gewissen in der Tasche. Wenn nun dieses am grünen Holze geschieht, von einem ausgezeichneten Gelehrten, von einem verständigen, in der Welt lebenden Manne, so frage ich, was haben wir von der großen Masse der polnischen Juden gar nicht zu gedenken, in dieser Beziehung zu erwarten?
Ich für meine Person werde mein Votum gegen den vorliegenden Gesetzentwurf geben, weil ich von der Korporierung von Leuten, die keine Korporation bilden wollen, keinen Vorteil erwarten kann, weil eine Korporation, wenn die ganze Korporierung von den Beteiligten mit Vorurteil und Abneigung aufgenommen wird, ein todgeborenes Kind bleibt. Ich für meine Person würde für die Ausdehnung des Gesetzes von 1812 auf sämtliche Provinzen stimmen, vielleicht mit einem Vorbehalt, in Beziehung auf Posen diejenigen exzeptionellen Bestimmungen zu treffen, die der Grad der Sittlichkeit vieler dortigen Juden in Bezug auf Eigentum notwendig machen könnte. Außerdem, wenn der Zustand der polnischen Juden wesentlich verändert würde, so könnte dies eine bedeutende Attraktionskraft auf Millionen russischer Juden ausüben, die in Rußland, meines Erachtens, sich nicht mehr heimisch fühlen können. Ob aber eine Übersiedelung derselben wünschenswert ist, überlasse ich denen zu beurteilen, welche das Glück gehabt haben, russische Juden en masse kennenzulernen. Ich glaube auch, daß die in Posen ansässigen Juden, auch wenn es ihnen erlaubt wird, nicht in bedeutenden Massen nach den deutschen Provinzen auswandern werden, weil die vergleichsweise – ich möchte nicht gern einen Ausdruck wählen, der verletzen könnte – Sorglosigkeit des polnischen Charakters in Beziehung auf zeitliche Güter den Juden aus Polen stets ein Eldorado gemacht hat. Ich glaube, daß das Gesetz von 1812 auch den Juden willkommen sein wird, ich muß sogar annehmen, nach dem, was ich hier von der Tribüne öfter gehört habe, daß gerade dieses Gesetz zu denen gehört, welche die damaligen Juden zur Teilnahme an dem vaterländischen Kampfe begeistert haben; auch von dem jungen Manne von neunzehn Jahren, von dem gestern erzählt wurde, glaube ich dies annehmen zu können. Ich erwähne diesen hauptsächlich deshalb, weil mir eine Äußerung, welche der verehrte Redner, der diese Erzählung vortrug [Beckerath], gestern machte, schmerzlich war und mit den vaterländischen Gefühlen, welche ihn gewöhnlich beleben, nicht im Einklang zu stehen scheint. Er sagte, es wäre schon genug, wenn schon ein einziges Menschenleben vergebens geblutet hätte. Nun kann ich nicht glauben, daß ein Blut vergebens geflossen ist, welches für die deutsche Freiheit floß, und bisher steht die Freiheit Deutschlands nicht so niedrig im Preise, daß es nicht der Mühe lohnte, dafür zu sterben, auch wenn man keine Emanzipation der Juden damit erreicht. Ferner haben mehrere Redner wieder auf das nachahmungswerte Beispiel von England und Frankreich verwiesen. Diese Frage hat dort weniger Wichtigkeit, weil die Juden nicht so zahlreich sind wie hier. Ich möchte aber den Herren, die so gern ihre Ideale jenseits der Vogesen suchen, eins zur Richtschnur empfehlen, was den Engländer und Franzosen auszeichnet: das ist das stolze Gefühl der Nationalehre, welches sich nicht so leicht und häufig dazu hergibt, nachahmungswerte und bewunderte Vorbilder im Auslande zu suchen, wie es hier bei uns geschieht! (Bravo!)
(Auf Gegenreden von Vincke bedauerte und Beckerath erwidert Bismarck:) Es ist mir nicht erinnerlich, davon gesprochen zu haben, daß es erlaubt sei, das Opfer eines fremden Menschenlebens für andere Zwecke als die des Vaterlandes in Anspruch zu nehmen. Ich habe nur dem Vaterlande und nicht der Emanzipation dieses Opfer als eines vindziert, welches ich für so notwendig halte, daß ich es nicht einmal sehr hoch anschlage. Im Gegenteil, die Abwesenheit der Fähigkeit, dieses Opfer dem Vaterlande ohne Nebenzwecke zu bringen, ist mir ein wesentlicher Fehler an jedem Manne und namentlich an jedem Deutschen! Wenn das eine mittelalterliche Ansicht ist, so bekenne ich mich dazu.